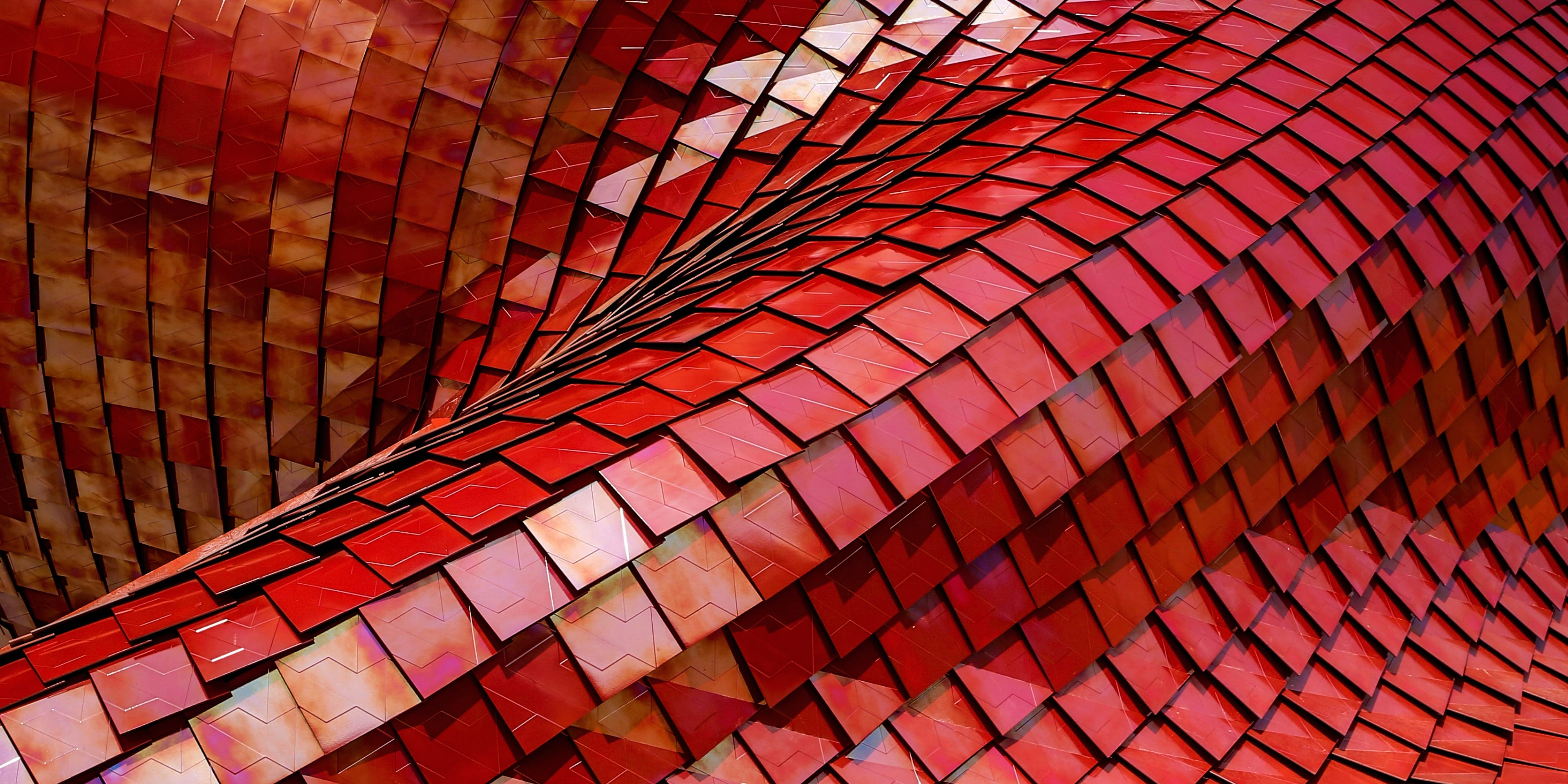Die riesigen Reklametafeln, die unsere Städte lügnerisch verschandeln, entbergen manchmal in ihrer Zusammenstellung und quasi gegen ihren Willen so etwas wie eine Wahrheit.
Beispiel 1 – im U-Bahnhof „Kochstraße“ von rechts nach links gelesen:
„STASI“ (das Wort wirbt für eine Ausstellung über das Wirken des Ministeriums für Staatssicherheit) und „We have ways of making you talk!“ (Werbung für eine Sprachschule)
Beispiel 2 – im U-Bahnhof „Stadtmitte“ von links nach rechts gelesen:
„Topographie des Terros“ verbunden mit einem Luftbild Berlin von oben (Werbung für eine Ausstellung) und „Unsere Litfaßsäulen sind überall, wo was los ist“ (wo Terror ist?!), und daneben „Wartezeit ist Werbezeit“ (Man soll in Buswartehäuschen für seinen Scheiß werben!)

Bus/Tramwartehäuschen im Prenzlauer Berg

Buswartehäuschen in Neukölln

Tramwartehäuschen am U-Bahnhof Vinetastraße

Buswartehäuschen in Schöneberg

Buswartehäuschen in Reinickendorf

Buswartehäuschen in Pankow

Tramwartehäuschen in Plötzensee

Buswartehäuschen im Wedding. Alle Photos: Katrin Eissing

Buswartehäuschen in Havanna. Photo: Bettina Vismann

Weddinger Buswartehäuschen mit Briefkästen. Photo: Andreas Ammer
Zum momentanen Stand der Glücksforschung
Na, wo ist es denn?“ So könnte die zentrale Frage lauten, die die Glücksforscher umtreibt. Nicht genug, dass die „Jagd nach dem Glück“ in der amerikanischen Verfassung verankert ist, es gibt in der „amerikanischen Welt, in der wir inzwischen alle leben (und immer mehr darin unglücklich werden), sogar einen internationalen „Glücksindex“ – also so etwas wie ein Staaten-Ranking.
An erster Stelle stehen dort Bhutan und Brunei, „aufgeklärte Diktaturen“, wie der Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Kurt Kotrschal weiß, „Bhutans Herrscher erhob sogar das Glück des Volkes noch vor Wohlstand zum Staatsziel. Ähnlich schrullig für unsere Begriffe das Sultanat Brunei. Etwa 350.000 Bruneier leben offenbar glücklich in der Nordecke Borneos. Sie haben nichts zu sagen, weil ihr Herrscher, Sultan Hassanal Bolkiah alles bestimmt. Der herrscht mittels Wohlstand und gemäßigtem Islam. Die Menschen werden im Schnitt 77 Jahre alt und gehen mit 55 in beitragsfreie Pension. Gratis sind auch das gute Gesundheits- und Schulsystem. Die Leute sind gut gebildet, 95 Prozent können lesen und schreiben. Private zahlen keine Steuern. Autos sind unschlagbar billig, der Sprit kostet 20 Eurocent, und die vielen Staatsdiener bekommen für alles und jedes einen zinsenfreien Kredit. Alles von Herrschers Gnaden, er verteilt die reichen Erdöl- und Gaseinnahmen quasi nach Gutdünken.“
Zwei englische Glücksforscher fragten sich vor einiger Zeit anhand einer US-Langzeitstudie, ob sich das Glücklichsein auch auszahle – quasi rechnet. Ja, das tut es: „Wer sich im Teenageralter als glücklich begriff, verdiente 10 Jahre später deutlich mehr als einst unzufrieden gewesene Teenager.“ Inzwischen hat die Glücksforschung derart Konjunktur, dass immer kühnere Thesen dazu auf den Markt kommen. Die Wissensredaktion der „Zeit“ ließ z.B. wissen: „Die menschliche Psyche reagiert empfindlich auf Geld. Es macht nicht glücklich genug – und fördert den Egoismus.“ Das war aber noch längst nicht kühn genug gedacht, denn jüngst veröffentlichte eine Gruppe schottischer Primatologen erste Ergebnisse ihrer ebenfalls auf Langzeit angelegten Glücksforschung – unter gefangen gehaltenen Menschenaffen (dazu studierten sie 336 Schimpansen und 172 Borneo-Orang-Utans in Zoos und Forschungseinrichtungen). Heraus kam dabei – für die Primatologen nicht überraschend, dass es keinen Unterschied im Glücksempfinden über den Lebenslauf von Menschen und Affen gibt: Man „startet frohgemut ins Leben“, wird zur Lebensmitte hin „immer mißmutiger“, aber im Alter „wieder besser gelaunt“ – so faßte die Süddeutsche Zeitung das Ergebnis zusammen, der dies jedoch „ein Rätsel“ blieb, denn: „Menschenaffen mittleren Alters müssen keine Kreditraten für Doppelhaushälften in der Vorstadt abzahlen, die Kinder rechtzeitig zur Schule bringen, mit dem Ehepartner streiten, das Smartphone bedienen und sich um das tägliche Brot kümmern, zumindest im Zoo nicht.“
Dass es gerade dieses Häftlingsleben ist, das die Menschenaffen in eine „Midlife-Crisis“ (Der Spiegel) stürzt, kommt für den FAZ- ebenso wie für den SZ-Wissensredakteur als Antwort nicht in Frage. Stattdessen führt dieser zwei weitere Glücksforschungsergebnisse an: 1. Eine Studie des schottischen Psychologen Alexander Weiss, in der dieser bewies, „dass glückliche Orang-Utans – ähnlich wie Menschen länger leben“. Und 2. eine anonyme Glücksforschung (unter Afrikanern?): „Selbst in Entwicklungsländern findet sich die umgedrehte U-Kurve der Lebenszufriedenheit.“ Diese arten-, ethnien- und klassenübergreifende Kurve, da sind sich denn auch die schottischen Primatologen einig, kann nicht mit den „klassischen sozioökonomischen Kräften“ erklärt werden – sondern nur mit „biologischen Gründen“. Fast hätten sie dafür erneut die BILD-Schlagzeile „Endlich! Glücks-Gen entdeckt“ verdient. Diese wohlfeile „Forschung“ – seit 2000 wird jedes ökonomische, soziologische und psychologische Phänomen auf dumpfdarwinistischste Weise zu einem biologischen Problem erklärt – läuft stets darauf hinaus, dass man das betreffende Gen isoliert und/oder ein Medikament gegen das jeweilige (Unglücks-)Phänomen auf den Markt wirft.
In Berlin fand kürzlich im Zentrum für Literatur- und Kulturforschung der dritte Kongreß über Vererbung statt, auf dem es erneut um Epigenetik ging – d.h. um „nichtgenetische Übertragungsprozesse“. Das ist schon mal löblich, aber auch in der Epigenetik ist noch viel zu viel Genetik. Es gilt doch, endlich der zeitlosen Wahrheitstheorie der herrschenden naturwissenschaftlichen Erkenntnislehren den Boden zu entziehen! Für Literatur- und Kulturwissenschaftler müßte das eigentlich selbstverständlich sein. Um es aber mit den Worten einer Physikerin zu sagen: „Der Satz der Identität in der Logik – A gleich A: Da raus zu kommen, das ist doch die wirkliche Aufgabe.“ – Das eigentliche Glück also! Für die Menschenaffen freilich kein Kunststück, aber was nützt ihnen das, wenn sie dafür lebenslänglich inhaftiert werden?!

Zier-Buswartehäuschen in Erkner

Werbeträger in Neuköllner Buswartehäuschen

Buswartehäuschen in der Schoenhauser Allee mit illegaler Werbung

Buswartehäuschen mit „Illegalem“

Buswartehäuschen ohne Jemand (alle Bus/Tramwartehäuschen-Photos: Katrin Eissing)
Warten
„Selbst die freiwilligen Handlungen werden einem inzwischen aufgezwungen.“ (St. J. Lec)
Als ich dieser Tage Morgens um 7 mit dem 29er-Bus zur taz fuhr, bemerkte ich, dass das Buswartehäuschen und der Platz drumherum in der Wiener Straße am Görlitzer Bahnhof täglich und ebenso zeitig von einem älteren Arbeitslosen, der um die Ecke wohnt, sauber gemacht wird. Einfach so. Als ich dann auch noch in der Zeitung ein Photo von einer vielköpfigen Familie aus Kurdistan sah, die in Istanbul in einem Buswartehäuschen wohnt, mit einem Teppich davor.. Und dann noch ein weiteres Photo aus der Uckermark, auf dem man ein Buswartehäuschen an einer Landstraße sieht, an dem jedoch nie ein Bus hält, es soll bloß über die Oder gekommene illegale Einwanderer täuschen: Wenn sie dort warten, werden sie früher oder später von einer Grenzschutz-Patrouille aufgegriffen…Da war plötzlich mein Blick für Buswartehäuschen gewissermaßen reif.
An der Landstraße zum Gut Neuendorf bei Buchholz entdeckte ich auf einem Ausflug ein frisch geweisstes Buswartehäuschen. Statt einer Sitzbank befand sich innen ein Tisch mit einer roten Samtdecke, auf der Orangen aus Israel lagen, die man während des Wartens essen konnte/sollte. Für Nachschub sorgte ein Künstler: Claudius Wachtmeister. Seine Arbeit war Teil einer Erinnerungs-Ausstellung der Gruppe „LandKunstLeben“ auf dem Gut Neuendorf, das einmal bis zur Enteignung durch die Nazis in jüdischem Besitz war und zuletzt als „Hachscharah“ diente: als Ausbildungsstätte für Juden, die nach Palästina auswandern und dort in einem Kibbuz arbeiten wollten.
In Berlin gestaltete der Hamburger Künstler Thorsten Brinkmann im Auftrag der Stadtreinigungsbetriebe einen „Bus Stop“ aus Sperrmüll, den er neben dem Dom aufstellte. In einem Zeit-Magazin fand ich eine große Bild-Reportage über die Landjugend in Schleswig-Holstein, die ihre Freizeit zumeist in den Buswartehäuschen ihrer Dörfer verbringt. Auf dem Heavy-Metalfestival in Wacken spielte die witzigste Combo im örtlichen Buswartehäuschen. Der Bundesverband der Jungbauern warb auf der Grünen Woche für sich mit einem Buswartehäuschen. Die österreichischen und bayrischen Jungbauern gaben daneben (und nun alljährlich) Kalender mit Photos von halbnackten Jungbäuerinnen heraus, eine ließ sich im Buswartehäuschen ihres Dorfes ablichten. Die Attraktivsten präsentierte der „Playboy“ in „sexy Dessous“. Die Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, Magdalena Zelder, gab auf dem letzten Deutschen Bauerntag die Losung aus: „Landwirt zu werden muß in Zukunft cooler sein, als BWL zu studieren“.
Bei Altenbruch baute eine Jugendgruppe in Eigeninitiative ein Buswartehäuschen aus Holz: „schade, dass sie es nicht aufstellen durfte,“ meldete der NDR. Am Ortsausgang von Thallichtenberg in Richtung Pfeffelbach wurde ein Buswartehäuschen aufgestellt, das die „Oie AG“ dem Bürgermeister „sponsorte“. In einem Berliner Seniorenheim stieß ich in dessen Garten auf ein Buswartehäuschen. Es wurde für seine dementen Insassen aufgestellt, für die es eines der wenigen Erinnerungen darstellt, die sie noch haben, weswegen sie – die einst eventuell ihre Jugend in einem solchen Buswartehäuschen auf dem Land verbracht hatten – sich gerne in diesem Buswartehäuschen des Pflegeheims aufhalten. Ebenfalls in Berlin – am Kreuzberger Mehringplatz hat man neben den Parkbänken, auf denen sich die Penner treffen, noch zusätzlich ein Buswartehäuschen für sie aufgestellt, damit sie bei Regen nicht naß werden. Den Pennern am Oranienplatz stellte man stattdessen ein futuristisches Pissoir neben ihre Parkbänke, damit sie ihren Restalkohol nicht in die Büsche pissen. Dafür wurde das Altberliner Pissoir am Heinrichplatz vom Bezirksamt entfernt und – generalüberholt – auf dem Rüdesheimerplatz in Wilmersdorf wieder aufgestellt, wo man anscheinend pfleglicher damit umgeht als im „Problembezirk“ wo es jedoch ebenfalls darum geht, das die dort am Platz sich in einem gediegenen Weingarten betrinkenden Nichtpenner ihren Restalkohol nicht in die Büsche der Gartenanlage oder gar in den Brunnen davor abschlagen.
In einer Kneipe am Schlesischen Tor kam ich mit einer Kellnerin ins Gespräch, die eine zeitlang von der BVG ausrangierte Buswartehäuschen per Schiff nach Gambia exportiert hatte, wo sie jedoch nicht zum Warten, sondern als Regen- und Staub- Schutz für große Trommeln, die man auch Buschtelefon nennt, benutzt werden. Man spricht deswegen dort auch von Buschtelefonhäuschen. Sie werden dort gepflegt, u.a. immer mal wieder gestrichen, und zudem bewacht.
In der Rhön – im bayrischen und im thüringischen Teil – haben einige Kulturwissenschaftler aus Würzburg ihre dorfsoziologische Studie mit einem Vergleich der Inschriften in den Buswartehäuschen – des Ostens („Sven liebt Chantal“) und des Westens („Stardust – Lena“) – begonnen.
Auf der Fahrt nach Strausberg kam ich an einem umgekippten Buswartehäuschen vorbei, auf das jemand ein großes Anarcho-A gesprüht hatte, und hinter Oranienburg entdeckte ich ein halbkaputtes Wartehäuschen, auf dessen Innenwand „Nazis raus!“ stand.
Die Freie Presse Sachsen meldete, in Kühberg habe ein Betrunkener mit seinem Auto ein hölzernes Buswartehäuschen im Wert von 9000 Euro völlig zerstört. Auf der Berlinale kuckte ich mir einen weißrussischen Dokumentarfilman, der ausschließlich in und vor einem großen Buswartehäuschen an einer Landstraße im Winter spielte. Alle Zuschauer waren begeistert.
Der interkulturelle Kinder-, Jugend- und Familienstützpunkt „BUS–STOP“ e.V. gibt bekannt, dass er seinen Bus zusammen mit den Kindern und Jugendlichen aus der Thermometersiedlung zu seinem Stützpunkt umbaute. „Die Polizei stellte daraufhin eine spezielle „Bus-Haltestelle“ in der Thermometersiedlung/Fußgängerzone bereit. So entstand der Kinder- und Jugendstützpunkt ‚BUS-STOP‘. Diese Bushaltestelle gab dem Projekt den Namen, der bis heute aus Tradition beibehalten wurde. Mit speziellen Projekten und täglichen Angeboten reagieren wir mit Kooperationspartnern aus dem Kiez mobil und flexibel auf die ständigen Herausforderungen, die sich aus den permanent entwickelnden Notwendigkeiten ergeben.“
Nicht wenige deutsche Regionalkrimi-Autoren plazieren ihre Leiche(n) inzwischen in Buswartehäuschen. Ich vermute, weil immer öfter in der australischen und amerikanischen Presse von „Bus Stop Mördern“ die Rede ist. Daneben aber ebenso oft auch von „Bus Stop Geburten“. In den angloamerikanischen Buswartehäuschen wird glaube ich viel mehr gelebt, aber auch viel mehr gestorben als in den hiesigen. Das Warten in diesen Häuschen scheint dort fast eine Art Nullsummenspiel zu sein. Vielleicht geht das in diesen von Massenmedien zusammengehaltenen Gesellschaften auf den erfolgreichen Marilyn-Monroe-Film „Bus Stop“ zurück? Das führte erst zu „Sexy Bus Stop Girls“ und dann zu „Bus Stop Pornos“, was dort inzwischen ein eigenes Genre ist.
Auf dem Weg ins süddeutsche Biberach wird die Buswartehäuschen-Architektur immer abwechlungsreicher: Es gibt gemauerte, gekachelte, gefachwerkte, reitgedeckte und aus einem Guß gepresste. Allerdings sind die Buswartehäuschen in und um Biberach keine Aufenthaltsorte für Jugendliche und andere Müßiggänger.
Um die Schulkinder zu schocken, hat ein Unbekannter im Buswartehäuschen an der Staatsstrasse 2110 bei Nailing Pornobilder ausgelegt, die Polizei ermittelt. In Biberach fand eine Ausstellung über die „Buden-Kultur“ des Landkreises statt. In diesem stehen fast 200 Buden – das sind nicht selten ziemlich luxuriöse Unterkünfte abseits des Dorfes, die sich die Jugend eingerichtet hat. Sie ersetzen ihnen dort die trostlosen Buswartehäuschen. Ein ostdeutscher Künstler hat eins dieser Biberacher Buden nach Küsserow in Mecklenburg transportiert, wo er sie der dortigen Buswartehäuschen-Clique zur Nutzung überließ. Die mobile Bude wurde von ihnen gut angenommen. Ihre Graffiti bringen sie jedoch nach wie vor in dem Buswartehäuschen ihres Ortes an, sie wollen damit nicht „ihre“ Bude beschmutzen – denke ich.
Auch einer der größten Buswartehäuschen-Hersteller kommt aus dem Schwäbischen: die Firma Liefcom. Sie bietet ihre „Fahrgastunterstände“ – mit Namen wie Pegasus, Zwilling, Matrix, Pluto, Venus, Mars, Saturn – in der ganzen Welt an, wobei die Benamung immer „spaciger“ wird. Die BVG verspricht dagegen den Berlinern zukünftig „mehr intelligente Wartehäuschen“ – mit „Internet-Terminal und Solarpanels bestückt“. Die BVG-Buswartehäuschen selbst liefert der Unternehmer Hans Wall – kostenlos, er darf sie dafür mit Leuchtwerbung bestücken.
Ein Hannoveraner Werbebüro wirbt mit dem Spruch „Sex sells Buswartehäuschen“, Ikea wirbt mit einem zum „Living Room“ ausgestalteten Buswartehäuschen und im Forum „Sex an ungewöhnlichen Orten“ erwähnt ein „Jippi (40)“: “ Buswartehäuschen im Winter“. Währenddessen mehren sich die Attentate (mit Flusssäure) auf die Berliner Buswartehäuschen, zuletzt wurden bei zweien am Schlesischen Tor die Scheiben verätzt. Sie mußten ausgewechselt werden, auch die Wall-Werbung wird oft zerstört.
Ein Neuköllner Quartiersmanagement bewog dieser Vandalismus bereits, eine Ausstellung in den dortigen Buswartehäuschen zu veranstalten – um sie besser ins Quartiersgeschehen zu integrieren. Es gibt schon die ersten Coffee-Table-Books über Buswartehäuschen – mit Titeln wie „Architekturen des Wartens“ und die Veröffentlichung eines „Internationalen Design-Projekts“, das neue Buswartehäuschen (für Hannover) zum Thema hatte. Auch die Firma Faller hat diese Häuschen mittlerweile im Angebot. Im Internet findet man unter dem Stichwort „Buswartehäuschen“ 20.000 Photos von ihnen, unter der englischen Bezeichnung „Bus Stop“ sogar 39 Millionen. Am futuristischsten sehen die armenischen aus, sie bestehen u.a. aus einer Betonhalbschale (auch über sie gibt es eine Publikation). Die komfortabelsten stehen in Dubai. Dort stellte man 1000 mit einer Klimaanlage ausgestattete Buswartehäuschen auf. Sehr bequem sieht auch ein natursteingemauertes Buswartehäuschen in Cornwall aus, in dem zwei Schaukelstühle stehen und Stilleben an der Wand hängen. Einige sowjetische Buswartehäuschen sind Moscheen mit Minaretten nachempfunden und sehr bunt.
Während ich noch nach einer Ordnung bzw. Vernunft in diesem plötzlichen Auftauchen des „Straßenmöbels Buswartehäuschen“ suchte, traf ich einen Ostberliner Ethnologen, er meinte: Nicht die Buswartehäuschen seien mir ins Auge gesprungen, sondern ihre ungebührliche Funktionsausweitung: Zusammen mit den Containern, denen Ähnliches passiere, symbolisieren sie die uns aufgezwungene neue Mobilität, die jedoch nirgendwo hinführt. Es gibt kein unterbesiedeltes Land mehr auf der Welt, wohin man die „Überflüssigen“ per Bus oder sonstwie schicken könnte. Alles wartet.

Treffpunkt Poller (Originaltitel: „Bad Girls“)

Treffpunkt Poller an der B 52 (Originaltitel: „An dieser Elf-Tankstelle legt Karl-Heinz jedesmal eine Pinkelpause ein“)
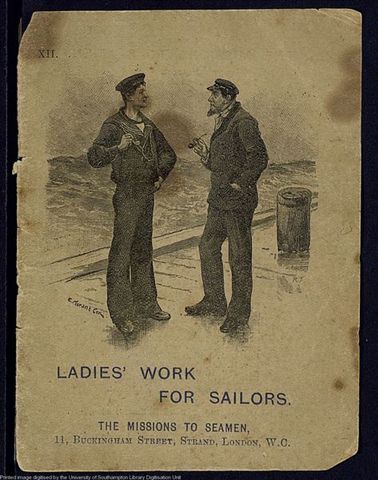
Treffpunkt Poller (Originaltitel: „Frauen arbeiten für Seeleute“)

Katzentreff Poller (Originaltitel: „Auf dem Weg zu den Uffizien erklärte mir Umberto Eco den Unterschied in der Interpretation von Dantes „Göttlicher Komödie“ [sowie Botticellis Illustrationen] zwischen Hegel und Mandelstam“)

Treffpunkt Poller (Originaltitel: „Ha Ho He – Union is OK!“)

Treffpunkt Poller (Originaltitel: „Wenn icks hier machen tu, dann everywhere!“)

Treffpunkt Poller Palm Beach (Originaltitel: „Ava Gardner bedankt sich hiermit für Ihre überaus freundliche Fanpost“)

Poller getroffen! (Originaltitel: „Menschliches Versagen auf See – Beispiel 11“)

Treffpunkt Pollerallee (Originaltitel: „Da hinten sieht man schon den Ballettmeister der Zagreber Oper kommen“). Alle Poller-Photos: Peter Loyd Grosse
Existentialethnologinnen
„Der Ethnologe ist oft unerwünscht“ (Philippe Descola, „Leben und Sterben in Amazonien. Bei den Jivaro-Indianern“)
Es gibt sone, die aus der Wildnis kommen -und solche, die es in die selbige zieht. Letztere, das waren einst Soldaten, Abenteurer und Entdecker, dann Missionare und Anthropologen, alle mit mindestens einer Versorgungseinheit, einheimischen Trägern, Photographen und Dolmetschern unterwegs. Heute reicht manchmal schon eine Kreditkarte und GPS. An einige Frauen sei hier erinnert, die nach einer solchen Erfahrung des Fremden Bücher darüber veröffentlichten. Die Verlage gaben ihnen Titel wie „Dschungelmädchen“, „Das Mädchen vom Amazonas“ oder ähnliche.
Nicht selten handelt es sich dabei um Erinnerungen einer Tochter von Missionaren oder Ethnologen, die in einem abgelegenen Dorf der „Dritten Welt“ aufwuchs – und nun mit den Lebensverhältnissen im Westen hadert, weil sich ihr laufend Kulturvergleiche aufdrängen. Während man allgemein von einer „Grünen Hölle“ spricht, empfand sie den Ort eher als ein „Paradies“ (so nennt Beirute Galdikas nebenbeibemerkt auch den halbwegs geschützten Urwald „ihrer“ Orang-Utans auf Borneo).
Daneben gibt es umgekehrt mindestens ebenso viele Biographien von erwachsenen Frauen, die von hier nach dort – zu einem „Naturvolk“ – zogen, wo sie dann aufs Existentiellste mit dessen Lebensverhältnissen konfrontiert waren (was man in gewiseser Weise auch von den drei Feldforscherinnen Goodall, Fossey und Galdikas sagen kann).
Eine Krankenschwester aus Espelkamp, Christine Lauterbach z.B.. Sie ging als Missionarin nach Tansania, um dort den Massai „medizinisch und geistlich zur Seite zu stehen und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten“. Dabei wandelt sie „zwischen den Kulturen hin und her“, wie die „Neue Westfälische“ Zeitung schreibt.
Das gilt auch für Nicole Mtawa, eine Bekleidungstechnikerin aus Schwäbisch Gmünd, die 2005 nach Tansania ging, um dort Straßenkindern zu helfen. Dabei lernte sie ihren ebenfalls obdachlosen Ehemann Juma kennen und gründete mit ihm zusammen eine Hilfsorganisation. Über ihr Buch „Sternendiebe“ urteilt die remszeitung.de: „Zarte Liebesgeschichte und ganz viel nüchterne Realität.“ In Nicole Mtawas zweitem Buch „Sonnenkinder“ geht es nicht mehr um Straßenkinder in Tansania, sondern um „Mein Leben für die Armen in Indien“.
Christine Lauterbach, die in Tansania ein Krankenhaus für Massai einrichtete, betitelte ihren Bericht ebenfalls sehr selbstbewußt: „Nashipai – Die die Freude bringt.“
Freude brachte wohl auch Corinne Hofmann zu den Massai: Die junge Geschäftsfrau verliebte sich im Urlaub in einen Massai-Krieger, zog zu ihm und seiner Mutter in einen Kral, bekam ein Kind, eröffnete mit ihrem Mann im Dorf einen Laden für Waren des täglichen Bedarfs und einen „Massai-Shop“ für Touristen in Mombasa – und flüchtete dann vermögenslos aber mit Kind wieder zurück nach Zürich, weil sie die Eifersucht ihres Mannes nicht länger ertrug. Ihr erstes Buch: „Die weiße Massai“ erwies sich als ein Weltbestseller und wurde verfilmt. Als die Autorin Jahre später ihren Ehemann im Busch noch einmal besuchte, traf sie dort auf die Schauspielerin Nina Hoss, die in dem Massaidorf für den Film gerade „Die weisse Massai“ sie – „Corinne Hofmann“ spielte. Diese Begegnung schilderte die Autorin dann in ihrem darauffolgenden Buch: „Wiedersehen in Barsaloi“.
Man lernt aus dieser Kulturstudie einer Verliebten viel über die „Ökonomie des [ethnologischen] Wissens“, die von den professionellen Forschern meist verschwiegen wird, höchstens dass sie noch die Anzahl der eisernen Töpfe, Äxte, Macheten in ihren „Expeditionsberichten“ erwähnen, die sie ihren Informanten im Tausch gegen Geschichten gaben. Die Schweizer Geschäftsfrau vergaß dagegen bei aller Romantik nicht, die ganze Zeit zu Rechnen, schon allein, weil ihr Massai-Krieger das überhaupt nicht konnte.
Wenn die in einem „Dschungeldorf“ aufgewachsenen Töchter weißer Intellektueller als Erwachsene mit Kindern wieder im Westen angekommen sind, engagieren sie sich nicht selten für „ihr“ armes Volk bzw. für indigene Völker überhaupt. Auf diese Weise bleiben sie mindestens geistig in „Kontakt“ mit ihrem Heimatdorf. Das gilt auch für all jene Frauen, die sich erst als Erwachsene in ein „Entwicklungsland“ begaben. Die Autorin Christina Hachfeld-Sapukai zog es ebenfalls zu den Massai – einer „unmöglichen Liebe“ wegen. Sie lebt bis heute in Kenia und veröffentlicht von dort aus ihre Lebens- und Liebesgeschichte quasi in Fortsetzungen – die zugleich Unterstützung für die Massai einfordern, deren traditionelle Lebensweise stark gefährdet ist, wie es zuvor schon die österreichische Naturforscherin Joy Adamson in ihren Langzeitstudien über „Die Löwin Elsa“ und „ihre Jungen“, die „US-Ethologin Cynthia Moss in ihrem Forschungsbericht „Die Elefanten vom Kilimandscharo“, und Richard Leakey, der Leiter der kenianischen Nationalparks in seinem Rechenschaftsbericht „Wildlife“ geschildert hatten. Christina Hachfeld-Sapukais erstes Buch hat den Titel: „Mit der Liebe einer Löwin“.
Umgekehrt fing die Missionarstochter Sabine Kuegler nach ihrer Rückkehr aus Indonesien hier an, wie eine Löwin für „ihr“ Volk: die Fayu in West-Papua zu kämpfen, indem sie die Befreiungsbewegung dort aktiv unterstützte. Auch ihr erstes Buch: „Dschungelkind“ wurde ein Bestseller. Die Autorin konnte sich desungeachtet nicht mit dem Leben im Westen anfreunden. Ob der vielen Enttäuschungen hier sehnte sie sich in die Gemeinschaft „ihres“ Fayu-Stammes zurück. Währenddessen wurde sie zu einer immer schärferen Kritikerin der brutalen indonesischen Politik auf West-Papua, bekam drei Kinder und veröffentlichte zwei weitere Bücher, in denen man erfährt, was sie, die als 17jährige „ihr“ Dschungeldorf verließ, in ihrem weiteren Leben so umtrieb und treibt. Man könnte hierbei von einer Emo-Ethnologie sprechen. Zuletzt veröffentlichte auch noch ihre Mutter, Doris Kuegler, ein Buch über ihr Leben mit ihren drei Kindern bei den Fayu: „Dschungeljahre“, u.a. erzählt sie darin laut Klappentext, „wie es dem Ehepaar gelang, den kriegerischen Fayu Begriffe wie Vergebung, Gnade und Liebe zu vermitteln.“
Die wissenschaftlichen Erforscher der immer weniger werdenden „Naturvölker“, von denen es keins mehr ohne „First Contact“ (mit Weißen) gibt, hüten sich demgegenüber, in die Gesellschaft aktiv einzugreifen. Sie wollen alles – die ganze Ökonomie, Kultur und Lebensweise einer fremden Gesellschaft, oft noch ohne ausreichende Sprachkenntnisse und in Zeit- bzw. Finanznot – in einer einzigen Geschichte erzählen und dabei möglichst „neutral“ bleiben. Hier ist es umgekehrt: Doris Kuegler kommt von ihren Erinnerungen an ihre Fayu-Kindheit auf sich als alleinerziehende Mutter im Westen zu sprechen – sie erzählt, wie ihr Leben hier weiter ging. Auch das Forschungsinteresse des Ethnologen kann sich wandeln. Corinne Hofmann studierte, bevor sie nach einigen Jahren ein Wiedersehen mit ihrem Ehemann in Kenia ins Auge faßte, die „Kung“ (Buschmänner), indem sie hunderte von Kilometer durch die „Halbwüste Namibias wanderte“. Sie folgte damit der US-Anthropologin Marjorie Shostak, die zwei Bücher über die Kung in Namibia und Botswana veröffentlichte, das letzte hieß: „Ich folgte den Trommeln der Kalahari“, Corinne Hofmanns Namibia-„Trip“ und auch die genaue Darstellung ihrer darauffolgenden Kilimandscharo-Besteigung ähnelt jedoch eher den Gewaltmärschen des Survival-Experten Rüdiger Nehberg, der sich bereits in allen Halbwüsten und Dschungeln umgetan und darüber Bücher veröffentlicht hat. Eins heißt: „Die Yanomami-Indianer: Rettung für ein Volk“. Auf Wikipedia steht in dem Eintrag über ihn: „Seine anfänglich aus reiner Abenteuerlust unternommenen entbehrungsreichen Expeditionen nutzte er später, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Seit 1980 setzt er sich für das Indianervolk der Yanomami in Südamerika ein“.
Die von Alexander von Humboldt erstmals erwähnten Yanomami werden seit dem Zweiten Weltkrieg von weißen Ethnologen, Medizinern, Filmemachern, Goldsuchern, Missionaren und Hilfsorganisationen geradezu umzingelt. Davon handelt die aufwendige Recherche des Journalisten Patrick Tierney: „Verrat am Paradies: Journalisten und Wissenschaftler zerstören das Leben am Amazonas“. In ihren Filmen bzw. Büchern verfälschen sie dann auch noch die wirklichen Lebensverhältnisse der letzten „First Nations“ dort aufs Reißerischste, indem sie ihre männiglichen Berichte irgendwo zwischen „Herz der Finsternis“, „Traurige Tropen“, „Apocalypse Now“ und „The White Man’s Burden“ ansiedeln.
So etwas geschieht auch anderswo: Die Zeitschrift „Bumerang“ vom Bund der Naturvölker veröffentlichte unlängst eine gründliche Recherche über einen medial gefakten „First Contact“. 1967 kam es zu der „anthropologischen Sensation des Jahrhunderts“: Im philipinischen Urwald wurden lebende Steinzeitmenschen entdeckt – die Tasaday. Schon bald wurden eine ganze Reihe Bestseller über sie veröffentlicht – von zumeist amerikanischen Anthopologen und Journalisten. 200 US-Fernsehgesellschaften, die Redaktionen von Geo und National Geographic und tausend andere setzten sich in Marsch. Sie mußten viel Geld zahlen: das meiste allein dafür, dass der philipinische Minister für kulturelle Minoritäten – Manuel Elizade – ihnen einen Besuch bei den „Höhlenmenschen“ auf Mindanao erlaubte. Er wählte aus, wer wie lange per Hubschrauber ins Reservat durfte, Prominente wurden bevorzugt: Gina Lollobrigida und Charles Lindbergh z.B., aber auch Deutschlands führender Humanethologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt, der ansonsten ebenfalls zu den Yanomami-Erforschern zählt.
Dann fand man jedoch heraus, dass es sich bei den Tasaday um 26 „gedungene Statisten“ handelte. Sie stammten aus Ubo- Dörfern in der Nähe, wurden von einem US-Paläolithiker namens Robert Fox ausstaffiert und dann vom Minister Elizade in die Berghöhle gesteckt, die er fortan von seine „Bodyguards“ bewachen ließ. Fox und Elizade veröffentlichten auch den ersten umfassenden Report über die „Tasaday“. Zwei von ihren Bewachern brachte Elizade einmal – als Tasaday verkleidet – nach Manila, wo sie US-Präsident Carter vorgeführt wurden, die „richtigen Steinzeitmensch-Mimen“ hatten zu viel Angst vor der Reise gehabt.
Patrick Tierney erwähnt neben den Yanomani, die nun angefangen haben, zurück zu filmen, zwei Frauen, die auf entgegengesetzte Weise noch einmal die Geschichte von den „guten Wilden“ erzählen: Zum Einen Helena Valero, die als Zwölfjährige von den Yanomami entführt wurde und seit über 50 Jahren mit ihnen lebt. „Sie erforschte als erste Weiße unzählige Gegenden, Flüsse und Bergketten, und sprach besser Yanomami als jeder andere Nichtyanomami,“ schreibt Tierney. Ihre auf Portugiesisch veröffentlichte Biographie hat den Titel: „Ich bin die Weiße Frau“. Ein Missionar verglich sie mit Homers Helena.
Zum anderen erwähnt Tierney die Yaromani-Indianerin Yarima, die einen US-Ethnologen heiratete und mit ihm nach New Jersey zog, wo sie als Mittelschichts-Hausfrau mit drei Kindern in einem Reihenhaus lebte. Über ihren Ehemann schreibt Tierney: „Durch die Heirat verschaffte Kenneth Good sich einen einzigartigen Zugang zur Gesellschaft der Yanomani, und er übertrug seine Liebe zu Yarima auf die Yanomani-Kultur.“ Seine Frau verließ ihn und ihre Kinder jedoch nach einigen Jahren – und ging zurück an den Orinoko in eine Dorfgemeinschaft der Yanomami. Sie hielt es in Amerika nicht länger aus: „Das einzige, was sie lieben, sind Fernsehen und Einkaufszentren. Das ist doch kein Leben,“ erklärte sie Patrick Tierney in einem Interview, in dem sie ihm gestand, dass sie inzwischen auch schon wieder das Zählen verlernt habe.
Daneben gibt es noch den Lebensbericht von Sueli Menezes: „Amazonaskind“, den sie mit Hilfe einer Journalistin veröffentlichte. Die im brasilianischen Dschungel aufgewachsene Autorin wurde von ihrem Pflegevater mißhandelt, ein weißer Ingenieur brachte sie daraufhin, als damals Sechsjährige, nach Manaus. Von dort gelangte sie als Tänzerin bis nach Wien. Heute ist sie Übersetzerin und engagiert sich für soziale Projekte in ihrer alten Heimat, sie lebt in Hamburg.
Eine ähnliche Geschichte stammt von Zoya Phan aus Burma, die ebenfalls mit einem Journalisten zusammen verfaßt wurde – unter dem Titel: „Tochter des Dschungels“. Die Autorin gehört zum Volk der Karen und ihr Vater kämpfte in der Karen-Befreiungsbewegung gegen die burmesische Militärdiktatur. Als ihr Dorf bombardiert wurde, flüchtete sie in den Dschungel. Von dort gelangte sie auf abenteuerlichen Wegen bis nach London, wo sie sich heute in der „Burma Campaign“ der Soros-Stiftung gegen die Militärdiktatur engagiert.
„Man muß den Dschungel als Ganzes sehen,“ meinte der kambodschanische Premierminister Hun Sen einmal in einem „Spiegel“-Interview, in dem es um die Bestrafung der Hauptschuldigen an den Verbrechen während des „Steinzeitkommunismus“ der Roten Khmer ging. An einer solchen erweiterten Sichtweise versucht sich derzeit auch die in einem Indianerdorf am Amazonas aufgewachsene Tochter eines Ethnologen-Ehepaars: Catherina Rust. Nachdem sie das Buch über ihre sechsjährige „Kindheit bei den Aparai-Wajana-Indianern. Das Mädchen vom Amazonas“ veröffentlicht und dann Ethnologie und Psychologie studiert hatte, engagierte sie sich für den Schutz der brasilianischen Ureinwohner. Derzeit schreibt sie an einem neuen Buch, das nicht die Fortsetzung ihrer Lebensgeschichte sein wird. Daneben arbeitet sie auch noch die wissenschaftliche Dokumentation ihres Vaters über die Kultur der Aparai-Wajana auf. Das erste Buch schrieb sie laut Vorwort für ihre Tochter, um der von ihrer ganz anderen Kindheit bei den Indianern zu erzählen.
Und dann gibt es da noch einen Bericht aus Afrika – „Lebensreise“ genannt. Er stammt von der kenianischen Tänzerin und Prostituierten Miriam Kwalanda und ist eine Art vorläufiges Résümee, aufgeschrieben hat ihn eine mit der Autorin befreundete Psychologin: „Die Farbe meines Gesichts“. Miriam Kwalanda heiratete in Mombasa einen deutschen Sex-Touristen.“Damit erfüllte sich ein Traum: Sie konnte nach Deutschland einwandern. Hier bekam sie ein Kind, lernte Deutsch und trennte sich von ihrem Mann. Anschließend machte sie eine Psychotherapie und bekam weitere Kinder.“ Heute lebt sie im Ruhrgebiet, wo sie sich „oft wie eine Ziege fühlt, die allein nach dem Weg sucht“.
Erwähnt sei ferner die in Holland lebende Autorin aus Nigeria Chika Unigwe: Sie schrieb die „Lebensreise“ dreier mit einem Fluchthelfer nach Europa gelangter Nigerianerinnen auf, die in Rotterdam leben, wo sie als Prostituierte arbeiten. „Schwarze Schwestern“ heißt ihr Bericht, den sie laut FAZ „auf dem schmalen Grat zwischen Literatur und Dokumentation“ verfaßte.
Zuletzt sei noch auf den schmalen Erzählungsband „Libysche Träume“ der Frankfurter Filmemacherin Pola Reuth hingewiesen. Als sie sich in den Achtzigerjahren mit einem Stipendium in Rom aufhielt, lernte sie dort einen Afrikaner kennen, der eine kolossale Irrfahrt hinter sich hatte: Er stammte aus Kosti im Sudan – und wollte unbedingt nach Europa. Immer wieder versuchte er, sich nach Norden durchzuschlagen. Mal über Ägypten und den Libanon, dann über den Tschad und Lybien. Einmal gelangte er bis nach Beirut, wo ihn die El Fatah sogleich als Söldner zwangsrekrutierte, er bekam Munition und Haschisch so viel er wollte, aber irgendwann landete er doch wieder in seinem Heimatland. Schließlich schaffte er es bis nach Rom – und dort endet auch seine letzte Geschichte. Jedes der fünfzehn Kapitel thematisiert einen seiner Fluchtversuche nach Norden. Die Geschichten-Aufschreiberin und -Bearbeiterin Pola Reuth half ihm, von Rom nach Hamburg zu gelangen, wo er einen Export-Geschäft mit gebrauchten Motoren aufmachte. Auch dabei half sie ihm, im Gegenzug bekam sie ein Kind von ihm. Die drei lebten einige Jahre zusammen, das Geschäft mit den Motoren lief gut, aber weil er befürchtete, entweder verrückt zu werden oder irgendwann Amok zu laufen, wenn er noch länger in Europa bliebe, kehrte er schließlich in den Sudan zurück, obwohl dort inzwischen Krieg herrschte. Die „Libyschen Träume“ enden mit einem Lied – von Eddy Grant: „Hello Africa, tell me how you do Africa, you sent me away with an empty heart, but I wanna get back and make a fresh start“.
taz 21.2.1998: Herzblut unter Palmen. Eine Frau hat es in die Südsee verschlagen. Sie schreibt darüber. Von Edith Kresta. Der Traum von den freundlichen Inseln der Südsee hat sich als Bild vom Paradies in unseren Köpfen festgesetzt. „Den Traum von den freundlichen Inseln“ träumte auch Anette Magdalena Moranz, geboren in Hennigsdorf bei Berlin. Und sie schrieb unter diesem Titel ein Buch. Zusammen mit ihrem deutschen Mann wagte sie den Ausstieg. Sie gaben ihre gesicherte Existenz in Deutschland auf. Tonga, der winzige Fleck am anderen Ende der Welt, war das Ziel ihres Auf- und Ausbruchs. Prompt verliebte sich Anette in Land und Leute. So nachhaltig, daß sie ihren Mann verließ und den Tongaer Keneti heiratete. Keneti ist ganz der Archetyp des unverdorbenen Fischers. Der Mann im Naturzustand. Soweit die traumhafte Seite der Geschichte. Und diese hat Anette Magdalena Moranz, die heute Aneti M. Moimoi heißt, nie losgelassen, trotz herber Enttäuschungen, familiärer Katastrophen. Aneti bekam zwei Kinder und mußte sich mit ihrer Familie recht und schlecht durchschlagen, während er sich den männlichen Gepflogenheiten ergab: Nächte mit seinen Freunden durchzechte und außer Haus verbrachte. Auch das Leben unter Palmen ist nur selten eitel Sonnenschein. Aneti ist eigentlich unglücklich, kommt mit vielen kulturellen Selbstverständlichkeiten nicht klar. Doch sie bleibt ihrem Südseeparadies unbeirrt treu: „Meine Miene verrät nichts vom Trauerspiel meiner Seele. Mich umarmt ja die Sonne. Dort am Hotel-Pool unterm Sonnenschirm kann ich nach Lust und Laune für ganze sechzig Cents (für die Eistüte) in eine andere Rolle schlüpfen. Und zwar so gekonnt, daß ich den Unterschied zwischen Phantasie und Wirklichkeit selbst nicht mehr zu erkennen vermag.“ Das ist vielleicht ihr Dilemma. Träume halten sich eben hartnäckig. Das Buch, das nicht gerade als literarisch wertvoll glänzt, bringt viel vom Alltagsleben auf Tonga rüber. Es gibt Einblick in die Wertigkeiten der tongaischen Gesellschaft. Und es schildert die Dramen des Zusammenlebens verschiedener Kulturen. Hautnah. Anetis Aufzeichnungen über 15 Jahre in Tonga sind persönlich, gemütsvoll. Dieser intime Blick ins Leben der Aneti M. Moimoi ist sicherlich für den Leser herzzerreißend voyeuristisch, ein traumhaftes Mißverständnis aus erster Hand. Für Aneti ist es das gnadenlos ehrliche Drama vom Glück. Herzblut unter Palmen, ganz im Stile von Courths-Mahler. Das Buch ist leichte Kost für heiße Tage unter Südseepalmen. Aneti M. Moimoi: „Der Traum von den freundlichen Inseln“.

Pollertreffpunkt für Prostituierte (Originaltitel: „Berlin, Kurfürstenstrasse“)
KONKRETISIERUNGEN:
1. Oberschwäbischer Budenzauber
Statt prekäre Jobs prekäres Wohnen, dachte ich, als im vergangenen Sommer eine Zugmaschine mit Wohnwagen an mir vorbei lärmte. Das Gespann kam laut Nummernschild aus Biberach (BC): Ziehen die Schwaben schon mit ihrem eigenen Häusle nach Kreuzberg?
Weit gefehlt, wie ich jetzt dem Katalog „Buden“ entnehmen konnte. Er wurde von der Leiterin des Museums Villa Rot bei Burgrieden, Stefanie Dathe, nach einer Ausstellung zum Thema zusammengestellt. Sie spricht darin von einer „oberschwäbischen Budenkultur“. Die dortige Polizei zählte 208 Buden im Landkreis Biberach, dazu noch weitere im angrenzenden Alb-Donau-Kreis. Die Buden, das können ausrangierte Wohn-, Bau- oder Campingwagen, leere Container, unbenutzte Holzhütten oder Kartoffelkeller, selbstgebaute Baumhäuser oder Schuppen sein, die zu „sturmfreien Buden“ umgenutzt wurden. Die „Budisten“ sind zwischen 14 und 50 Jahre alt, sie sondern sich erst mit ihrer Bude ab, verschmelzen dann aber im Laufe der Zeit wieder „organisch mit dem Dorf“, wie es im regionalen Kulturmagazin „Blix“ heißt. Es geht diesen „Cliquen“ dabei um Geselligkeit.
Früher einmal war die Geselligkeit identisch mit Gesellschaft – „in der die Menschen einander ‚freudig‘, ‚gleich‘, ‚offen‘ begegnen“, sie war „konversierende Interaktion, in der die Teilnehmer sich sympathisierend, symmetrisch, aufrichtig miteinander ins Verhältnis setzen,“ so der Germanist Georg Stanitzek über die adligen und bürgerlichen Zusammenkünfte im 18.Jahrhundert. Für den Soziologen Georg Simmel war die Geselligkeit dagegen nicht mehr unbedingt identisch mit der Gesellschaft, sondern eine ihrer „Spielformen“. Die oberschwäbischen Buden hatten als Vorläufer erst die Spinnstuben und dann einen quasi-öffentlichen Raum in einem Wohnhaus. Die Spinnstuben, auch „Kunkelstuben“ genannt, wo junge Männer und Frauen sich trafen, waren wegen des in ihr vermuteten „frivolen Treibens“ oft Gegenstand obrigkeitlicher Verordnungen. In Mietingen war der Übergang von der Spinnstube zur Bude fast fließend: Nur 16 Jahre nach Schließung der letzten Kunkelstube wurde dort 1967 die erste Bude – „Club 7“ – gegründet. „I moi, do send hald koine Schtruktura do wese, dann schafft ma sich hald selber Schtruktura,“ so sagte es ein Club-Mitglied.
Natürlich war hier wie dort immer auch Wein, Bier oder Schnaps im Spiel: Schon die Aufklärer, u.a. Kant, erörterten den Wein als Vehikel der „Offenherzigkeit“ (für Männer). Der Alkohol wirkt „als Antidot zu den Differenzen der Gesellschaft und den Egoismen der Männer“, ihre mit Wein verbundene Geselligkei „ist eine Art konkrete Utopie, die Versöhnung nach Feierabend“, schreibt der Soziologe Christoph Kulick. Etwas anders sieht das der Biberacher Polizeidirektor Hubertus Högerle – in seinem Katalog-Beitrag: „Ganz zu schweigen davon, dass Buden nach mehreren Rechtsvorschriften an sich nicht genehmigungsfähig sind, das heißt eigentlich rechtswidrig sind…Sie werden aber geduldet. Nach meiner Beobachtung wird bei uns vor allem beim Thema Alkoholmißbrauch geschönt. Und der ist bei Buden – leider – an der Tagesordnung. Es vergeht fast keine Woche, in der sich die Polizei nicht mit den unangenehmen Seiten unserer Buden beschäftigen muß. Dazu zählen junge Verkehrstote, Querschnittgelähmte, lebensbedrohlich Verletzte, Vergewaltigte, im Internet dauerhaft Bloßgestellte…“ Schon 1984 warnte der Obersulmetinger Ortsvorstand die dortigen Budisten im Amtsblatt: „rauchen, saufen, huren, haschen, kiffen, fixen, sind die Stufen der Leiter, die nur allzu viele Jugendliche zielstrebig zur Vollendung klettern und unterwegs auch Abstecher in die Kriminalität nicht scheuen, wenn es an der Penunze mangelt.“ Inzwischen scheint jedoch mindestens der CDU-Ex-MdB Franz Romer der Meinung zu sein, in den Buden lernen wir fürs Leben: „Ordnung und Sauberkeit müssen sein. Wenn es mal nicht sauber war, habe ich gesagt: ‚Leute, so geht’s nicht mehr, entweder ihr räumt auf oder die Bude kommt weg.“ Eigentlich ist aber für ihn der „Lärm“ aus den Buden „das größte Problem“. Ansonsten würde er wohl dem Soziologen Stefan Buri zustimmen: „Fest steht, dass das Buden-Leben einen wichtigen Beitrag zur Sozialisierung Jugendlicher auf dem Land leistet.“ Dies erkläre auch, warum viele Buden inzwischen fester Bestandteil des dörflichen Lebens sind. Einige Buden-Cliquen scheinen sich im übrigen die Mahnungen des CDU-Bundestagsabgeordneten zu Herzen genommen zu haben. So meldete z.B. die „Schwäbische Zeitung“ aus Biberach an der Riß: „Die ‚Kies-Bude‘ hat sogar einen Putzdienst!“ Zuvor hatte die Zeitung berichtet, dass die „Alte Bude Äpfingen“ eine erfolgreiche Aktion für mehr Schwalbennester startete, wobei die Clique gleichzeitig den Bürgermeister von Maselheim als „Schwalbenmörder“ kritisierte. „‚Wir greifen jedes Jahr ein aktuelles Thema auf,‘ erzählte Dietmar Hagel. ‚Und oft nehmen wir auch den Bürgermeister auf den Arm‘, sagte er. In zwei Nachmittagen fertigten ungefähr 15 Leute einen Platz für gut 30 Schwalbennester an und spannten es auf einen Umzugswagen. Der begeisterte Bürgermeister Elmar Braun nahm den angebotenen Tauschhandel gern an. ‚Die Gemeinde musste sich verpflichten, das Schwalbenhotel aufzustellen und mit der Bude einzuweihen‘, sagte Braun, während hinter ihm die letzten Handgriffe beim Aufbau erledigt werden und das Gerüst abgebaut wird. Pünktlich zur Rückkehr der Mehlschwalben wurde zusammen mit dem Bauhof eine stämmige Lärche aufgetrieben und das Schwalbenhaus in zwei Stunden errichtet.“ Der Sender „donau3fm“ berichtete: „Jugendliche haben in Senden eingelagerte Weihnachtsmarkt-Buden zu Skateboardrampen umgebaut. Laut der Polizei nutzen Jugendliche immer wieder das alte Webereigelände für Unfug. Dabei sei bereits ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.“ Deutet sich hier bereits eine Wende an, dass die heutige Jugend nicht leere Räume zu Buden umfunktioniert, sondern umgekehrt Buden zu sonstwas mißbraucht?
Im Ausstellungs-Katalog finden sich einige Buden-Genealogien: Sie haben Nummern (von Club 3 bis 15 in der Biberacher Gemeinde Mietingen z.B.) oder Namen (wie „Weiher-Bude“, „Hammelclub“ und „Drohnenclub Dietenwengen“), die sich „aus dem Standort, dem Namen des Grundstücksbesitzers oder einem Ereignis aus der Budengeschichte ableiten“. Die Namen können sich ändern, wenn nach einer Zeit des Leerstands eine neue Clique einzieht – und wieder Leben in die Bude kommt. So hatte die im Landkreis Biberach bekannte „Schmalzbude“, die es seit 1978 gibt, zwei Vorläufer in Gutenzell: einen „Saustall“ und einen „Backsteinkeller“. Nicht wenige Buden haben heute Internetanschluß und eigene Webpages – die „Riss Bude“ z.B (eine Halle im Industriegebiet von Obersulmetingen, wo die 12 „Mitglieder“ zwei mal im Jahr große Parties organisieren).
Den Buden Vergleichbares gab es auch anderswo in Deutschland ab den Sechzigerjahren – zunächst in den Städten: Die Jugendlichen rebellierten und begehrten mindestens eigene Räume, die sie besetzten oder erbettelten und dann „Jugendzentrum“ bzw. „-treff“ nannten. In Limburg bekamen sie z.B. einen Kellerraum von der Kirche, den sie „Club Black-Out“ nannten. Schon wenig später wollte der Bürgermeister ihn schließen lassen: „Die spritze sich da des pure Hasch!“ behauptete er von jeder Sachkenntnis ungetrübt. Eine der ältesten und immer noch aktivsten „Buden“ ist der „Club W71“ in Weikersheim südlich von Würzburg, er besteht seit 1971, Vereinsvorsitzende ist derzeit die Weinbäuerin Elsbeth Schmidt. Unter Literaten bekannt ist das „Büro“ des Rheinhausener „Agentenkollektivs“ vor dem Tor der stillgelegten Krupp-Werke – in einem ehemaligen „Büdchen“, wie die Kioske im Ruhrgebiet heißen. Die bekannteste „Bude“ nördlich von Oberschwaben steht heute wahrscheinlich in Rietschen, einem Dorf in Sachsen. Es ist ein ehemaliges LPG-Gebäude, das „Kommärzbanck“ heißt und ein deutschlandweit bekannter Punk-Schuppen ist. Die Jugendlichen bauten ihn sich mit Geldern aus, die der Pastor und der Bürgermeister des Dorfes ihnen besorgt hatten. Anderswo werden solche „Clubs“ von Wohlfahrtsverbänden und Jugendämtern betrieben. Allein im brandenburgischen Guben gibt es vier riesige „Jugendclubs: drei für Linke und einen für Rechte. Sie werden von Sozialarbeitern geleitet. Zwar gibt es auch Cliquen auf dem Land, die sich leerstehende Gebäude einfach aneignen, in der Lausitz z.B. vom Braunkohlekonzern verlassene Gebäudeteile, aber die meisten Dorfjugendlichen (in Ost und West) kennen als täglichen Treffpunkt nur ihr Buswartehäuschen.

Pollertreffpunkt für Prostituierte 2 (Originaltitel: „Diese strickenden Stricherinnen machen immer weiter. Vielleicht demonstrieren die damit gegen irgendwas? Oder für irgendwas!“)
2. Südbrandenburgische Hachschara
Nach der Gründung des Staates Israel kamen verstärkt jüdische Einwanderer ins Land. Sie wurden in ihren Herkunftländern buchstäblich freigekauft. Bulgarien und Rumänien z.B. verlangten 1000 Dollar pro Kopf. Viele wurden in palästinensische bzw. arabische Dörfer angesiedelt, deren Bevölkerung man zuvor vertrieben hatte oder die geflohen waren. Die meisten jüdischen Neusiedler hatten jedoch “keine Ahnung, wie sie das Land, das man ihnen zugeteilt hatte, kultivieren und was sie mit dem Vieh und Geflügel anfangen sollten, das man ihnen gegeben hatte,” schreibt der israelische Historiker Tom Segev. In der Knesset erklärte David Ben-Gurion 1950 warum:
“Früher haben wir einen Einwanderer erst nach jahrelangem Training ins Land gebracht. Wir hatten auf der ganzen Welt Pionierhöfe gegründet, und dort behielten wir die Pioniere mehrere Jahre lang, damit sie sich auf das Leben und die Arbeit vorbereiteten und die Sprache und das Land kennenlernten, bevor sie überhaupt herkamen. Jetzt bringen wir die Juden ins Land, wie sie sind, ohne jede Vorbereitung…weil wir nicht die Zeit haben und sie nicht die Zeit haben…”
Auf einem der ehemaligen “Pionierhöfe” in Brandenburg fand vor einigen Tagen eine Ausstellungseröffnung statt, die noch einmal an diese Geschichte erinnerte…
Am 15./16.August findet in Neuendorf im Sande (bei Fürstenwalde) eine Veranstaltung zur jüdischen Geschichte des dortigen Gutshofes statt. Nach der von der SPD niedergeschlagenen Revolution 1918 durften immerhin die Juden Land kaufen und Landwirtschaft betreiben. Der Berliner Unternehmer Hermann Müller erwarb damals das 245 Hektar umfassende Anwesen. Ab 1932 befand sich dort ein landwirtschaftlich ausgerichtetes Schulungslager, in dem Juden sich auf die Auswanderung nach Palästina – in einen Kibbuz – vorbereiteten. Schon bald gab es immer mehr solche Einrichtungen. Die Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Kommunisten lehnten sie ab, weil die dort Arbeitenden vom Gutsbesitzer ausgebeutet werden würden. Als 1933 die Diskriminierung der Juden in Deutschland wie beabsichtigt zunehmend unerträglicher wurde, gründete sich in Charlottenburg die “Jugend-Alija” (hebr. für “Rückkehr ins Gelobte Land”, wörtlich “Aufstieg”), sie übernahm die pädagogische Betreuung der Neuendorfer “Hachscharah” (hebr. für “Vorbereitung”). Gemäß des “Chaluz”-Ideals (hebr. für “Palästina-Pionier”) sollte die Ausbildung der auf dem Gutshof lernenden und lebenden Juden, unter ihnen auch viele Erwachsene, diese nicht nur fit für eine Arbeitsstelle dort machen und ihnen damit die Bewilligung eines englischen Einreisevisums nach Palästina erleichtern, sie sollten vielmehr das Bauern-Werden als Berufung begreifen. Es stand allerdings nicht die Qualifizierung zum Einzelbauern, der sich ökonomisch geschickt des kapitalistischen Agrarmarktes bedient, auf dem Lehrplan, sondern das Arbeiten und Leben in einem Landwirtschaftskollektiv. Dazu wurde die Berliner Montessori-Pädagogin Clara Grunwald als Lehrerin geholt.
Auf der Gutshofveranstaltung sind dazu jetzt einige Photos des Pressephotographen Herbert Sonnenfeld aus dem Jahr 1934 zu sehen. Es gab solche Pionierlager zur Vorbereitung auf die “Kollektiv-Siedlungen” in Palästina schon seit der Jahrhundertwende – nach jedem Pogrom, kann man vielleicht sogar sagen. Den ersten “Kibbuz” (das Wort wurde von dem aus Galizien stammenden Dichter Jehuda Ja’ari geprägt) gründete eine zionistische Gruppe aus Weißrussland “Degania A” im Oktober 1910 am See Genezareth.
In Russland hatten die Dörfer – Obschtschinas – bereits seit Jahrhunderten ihr Land gemeinschaftlich bewirtschaftet, sie wurden auch kollektiv besteuert. Mit der Revolution wurden daraus zunächst vollends selbstverwaltete Kibbuzim – partisanische Wehrdörfer. Als die Bolschewisten ihre Macht gefestigt hatten, begannen sie damit, die Dörfer staatlich zu durchdringen und also wieder zu zersetzen. Die berühmte “Zwangskollektivierung” war auch und vor allem eine Dekollektivierung. Nicht wenige sowjetische Schriftsteller, allen voran Andrej Platonow, haben vor dieser die Bauern entmündigenden und das Dorf zerstörenden Entwicklung, die vornehmlich auf die Technik setzte, gewarnt. Ihre Bücher wurde daraufhin nicht mehr gedruckt. Stalin schrieb an den Rand eines der Manuskripte von Platonow: “Schweinehund!”
Zuletzt – während der “Perestroika” (Umbau) – riet jedoch der letzte Generalsekretär der KPdSU (B), Michail Gorbatschow, den inzwischen völlig demoralisierten Kolchosen, sich selbst noch einmal umzugestalten – diesmal nach dem Vorbild der israelischen Kibbuzim. Das sollte zu einer Zeit geschehen, da die israelische Kibbuz-Bewegung selbst in eine schwere Krise geraten war – ein Kollektiv nach dem anderen löste sich in durchamerikanisierte Geschäftsbereiche und -gebaren auf. Die einzige Neugründung wagten 1991 einige jüdische Russen mit dem Kibbuz “Pelekh” bei Haifa. Der hochverschuldete Kibbuzverband “Artzi” unterstützte ihre Initiative großzügig: Sie war die erste wieder seit zwölf Jahren. 90% ihrer Mitglieder hatten einen Hochschulabschluß, die meisten wollten nicht in der Landwirtschaft arbeiten, aber “wir haben auch keine feste Ideologie”, meinte Theresia Tarasiuk, Gründerin, Managerin und Sekretärin des “russischen” Kibbuz. “Wir suchen auch nicht nach den idealen Kibbuzniks, es genügt bereits, wenn niemand hier dem Kibbuz Schaden zufügt.” Die Mitglieder wollen jedoch vorerst unter sich – unter Russen – bleiben. Ihre Satellitenschüsseln haben sie nach Moskau ausgerichtet.
Die “Hachscharah” in Neuendorf im Sande war nach 1933 eins von 26 Vorbereitungslagern in Deutschland. Es nahm bald auch die “Schüler” aus der “Hachschara” in Ahrensdorf bei Trebbin, vom Gut Winkel bei Fangschleuse und von Niederschönhausen auf. Die anderen Pionierlager mußten dem “Reichsarbeitsdienst” übergeben werden. Das Gut Neuendorf kam wegen besitzrechtlicher Unsicherheiten erst 1941 unter die Aufsicht eines SS-Wirtschaftsoffiziers in Fürstenwalde, zuvor war bereits über die Hälfte der Ländereien für den Bau eines Militärflughafens requiriert worden. Dieser ist noch heute in Betrieb. Kurzzeitig wurde erwogen, alle Juden in Madagaskar anzusiedeln, die in Neuendorf sollten sich schon mal darauf vorbereiten. Aber auf der Wannseekonferenz Anfang 1942 beschloß man stattdessen, die Juden zu vernichten. Aus der Hachscharah machte man erst einmal ein Zwangsarbeitslager.
So wurde z.B. einer ihrer “Schüler” – der spätere Entertainer des Deutschen Fernsehens, Hans Rosenthal – als Friedhofsgärtner in Fürstenwalde eingesetzt. Von dort aus gelang ihm die Flucht in eine Schrebergartensiedlung in Lichtenberg, wo er überlebte. Der letzten Berliner Leiterin der Jugendalija, Elli Freund, gelang 1935 die Ausreise nach Palästina, wo sie als Ärztin arbeitete. Als Rentnerin zog sie später zurück nach Berlin.
Der letzte Transport aus Neuendorf in die Vernichtungslager wurde im April 1943 zusammengestellt. Clara Grunwald begleitete die ihr anvertrauten Kinder nach Auschwitz in den Tod. Dort starb wenig später auch der letzte jüdische Gutsverwalter Martin Gerson, ein ausgebildeter Gartenfachmann, den man mit Frau und Kindern zunächst in das KZ Theresienstadt deportiert hatte.
Die DDR machte aus dem Anwesen in Neuendorf nach dem Krieg ein “Volksgut” (VEG). Dessen letzter Verwalter, Georg Weilbach, brachte im “Perestroika”-Jahr 1988, anläßlich des 50. Jahrestages der sogenannten “Reichskristallnacht” – des Pogroms von 1938, eine Gedenktafel am ehemaligen Schloßgebäude an (leider mit einer falschen Zeitangabe). Der Verwalter ist inzwischen gestorben, seine Frau Ruth kümmert sich jedoch seitdem um die jüdische Vergangenheit des Gutshofes. So unterstützt sie u.a. auch diese Veranstaltung jetzt.
Nach 1945 gründeten sich erneut eine Reihe von Hachscharas in Deutschland (u.a. bei Fulda und in der Rhön) – zumeist von Überlebenden aus den KZs sowie aus der osteuropäischen Partisanenbewegung. Erneut ging es dort darum, sich auf die Ausreise nach Palästina vorzubereiten. Die dortigen Kibbuzim, die anfangs z.T. noch durchaus freundschaftliche Beziehungen zu ihren arabischen Nachbarn hatten, waren inzwischen durchweg Wehrsiedlungen geworden. Nachdem 1948 Israel gegründet worden war, stellten die partisanischen Kibbuz-Pioniere für lange Zeit das Elitepersonal in der Armee und im Staat. Der Staat Israel wurde fast sofort von den USA und der UDSSR anerkannt. Aus diesen beiden Ländern kam dann auch seit Ende der Achtzigerjahre die letzte “Alija” (Einwanderungswelle). Einige Kibbuztheoretiker machen vor allem diese Juden für die sich seitdem verschärfende “Kibbuz-Krise” verantwortlich. Beide Gruppen wollen von kollektivem Arbeiten und Leben nichts (mehr) wissen und begreifen alle Genossenschaftsutopien als “Ideologie”. Unter den jungen im Kibbuz geborenen, aber jetzt in der Stadt lebenden Israelis hat sich seitdem aber das Modell eines “Urban Kibbuz” herausgebildet. Und auch in Russland sind in der Zwischenzeit wieder zigtausend neue Wirtschaftskollektive entstanden, viele knüpfen dabei bewußt an das alte “Obschtschina”-Konzept an.
Die Veranstaltung “Hachscharah – revisited” auf dem Gut Neuendorf wird von der Gruppe “Landkunstleben” im Nachbardorf Buchholz organisiert. Sie gehört dem märkischen “Netzwerk Raumumordnung” an und bewirtschaftet ansonsten den Schloßgarten in Steinhövel künstlerisch. U.a. indem sie mit der Aktion “Wir beeten für sie” etlichen Städtern ihren Wunschgarten erfüllt – auf jeweils 9 Quadratmetern. Zu ihrer Veranstaltung in Neuendorf gehören auch einige Kunstwerke – von Jörg Schlinke, Sybille Höfter und Claudius Wachtmeister. Ersterer wird eine “Erdskulptur” zum Thema beisteuern. Letzterer ließ sich dazu drei “Projekte” einfallen, nachdem er sich im Potsdamer “Moses-Mendelsson-Zentrums für europäisch-jüdische Studien” sowie im Berliner “Bauhaus-Archiv” mit Material versorgt hatte:
1. stellte er an einem Feld ein Bauschild auf, mit dem die baldige Entstehung eines “Haus der Pionierinnen” an Ort und Stelle angekündigt wird.
2. ließ er in der Bushaltestelle des Gutshofs die Bank entfernen und stattdessen einen Gewerbestand aufbauen, an dem fortan kostenlos Obst und Gemüse aus Israel angeboten wird.
3. stellte er eine Diaschau mit 50 bearbeiteten Photographien zusammen, die zeigen, wie die Juden damals in Palästina ankamen – mit kleinen Containern aus Holz, die im Hafen von Haifa abgeladen wurden. In ihnen befand sich das Hab und Gut der Einwanderer, im Kibbuz angekommen diente es ihnen als erste Unterkunft.
Noch heute stehen in dem einen oder anderen Kibbuz diese Container herum, von denen Claudius Wachtmeister behauptet, dass es sich dabei um die ersten Container überhaupt gehandelt habe. Aus Russland kamen die jüdischen Siedler zuletzt nicht selten mit Metallcontainern an. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wandern nun Griechen aus dem Kaukasus und der Krim wieder mit solchen Holzcontainern aus – nach Griechenland. Zunächst sind diese allerdings voll mit Handelsware, dass die Auswanderer in den Häfen an der Schwarzmeerküste nach und nach verkaufen. In Griechenland angekommen dient ihnen der inzwischen leere Container dann als eine erste Notunterkunft. Die heutigen illegalen israelischen Wehrdorfsiedlungen auf palästinensischem Land, zumeist von Amis aus Brooklyn, wie Amos Oz meint, bestehen anfänglich zumeist ebenfalls aus Wohncontainern – allerdings aus sehr komfortablen, sie werden dann zudem sehr schnell von der Armee an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen.
In Brandenburg nehmen die seit der Wende 1989/90 an der Gründung von legalen Landwirtschaftskollektiven Interessierten dafür gerne alte Wohn- und Bauwagen. Letztere konnte man nach der Wende billig aus der Konkursmasse pleite gegangener LPGen erwerben. Die EU fördert in Ostdeutschland und nicht nur dort inzwischen solche Agrarkooperativen. Und so steht denn auch diese Erinnerungsveranstaltung auf dem Gut Neuendorf durchaus in einem Spannungsverhältnis zu dem, was aktuell auf dem Land passiert.

Pollertreffpunkt am litauischen Strand (Originaltitel: „Papa fiel kurz nach diesem Schnappschuß rückwärts vom Poller.“)
3. Fake-Natur und Fake-Kulturen
Rechtzeitig zum Darwinjahr 2009 verkündete die Verwaltung des Nationalparks “Galapagos-Inseln”, dass sie das Naturschutzgebiet noch mehr als bisher schützen wolle, nicht zuletzt um den Tourismus zu fördern. So soll u.a. der Fischfang verboten werden, die Fischer will man dazu bewegen, Arbeitsplätze in der Tourismusindustrie anzunehmen. Sie weigern sich jedoch einstweilen noch. Während die eine Seite von Umweltschützern unterstützt wird, bekommt die andere Hilfe von Menschenrechtlern.
Über diesen Konflikt – zwischen Natur- und Menschenschutz – diskutierte kürzlich Mac Chapin im Berliner “Mehringhof”. Der Anthropologe ist Direktor des “Center for the Support of Native Lands” in Arlington, Virginia und arbeitet seit 40 Jahren mit indigenen Völkern im Lateinamerika zusammen. 2008 war zu dem Problem bereits das Buch “Naturschutz und Profit” von Klaus Pedersen erschienen, das sich nicht zuletzt einem Artikel von Mac Chapin im “World Watch”-Magazin 2004 verdankt (die Amis wollen immer gleich die ganze Welt overwatchen!).
Darin werden die großen amerikanischen Naturschutzorganisationen (WWF, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society u.a.) kritisiert – in ihrem Umgang mit den Einheimischen, die von ihren “Projekten” betroffen sind. Vordergründig wollen beide das selbe: Im Amazonasgebiet z.B. wollen die “conservationist” (Umweltaktivisten) den Regenwald schützen – und die dort lebenden “indigenous people” (Waldindianer) ebenfalls. 1990 unterzeichneten sie ein Kooperationsabkommen, aber es funktionierte nicht: Die Umweltschützer hatten das Geld und machten Pläne, die Einheimischen sollten helfen, diese umzusetzen. Ersteren ging es um den Erhalt der “Biodiversität” (ein Begriff, der damals gerade aufkam), letztere wollten verbriefte Rechte für ihr Territorium. Die Naturschutzorganisationen planten dessen “nachhaltige ökologische Entwicklung”, während die Einheimischen ihren Lebensunterhalt weiter mit den natürlichen Ressourcen dort bestreiten wollten. Dazu mußten und müssen sie sich mit mächtigen Gegnern (als Partner) arrangieren: Neben den Naturschutzorganisationen waren und sind das internationale Konzerne, sowie Großgrundbesitzer und die nationalen bzw. regionalen Regierungen und ihre bewaffneten Organe. Die “Waffen” der indigenen Völker sind diesen Mächten meist intellektuell und technisch unterlegen. Immer häufiger finden sie sich deswegen in Nationalparks oder Naturreservaten wieder – und werden fortan z.B. als “Wilderer” verfolgt, wohingegen zahlende Touristen in ihrem angestammten Territorium nach Herzenslust jagen und fischen dürfen. Anderswo werden sie von Agrarkonzernen vertrieben, die ihre Wälder abholzen, um Monokulturen anzulegen oder – wie in der Mongolei – von Bergbaukonzernen, die das Nomadenland ebenfalls großflächig verwüsten. In Somalia wurden die Viehzüchter dadurch dezimiert, dass man auf Druck von IWF und Weltbank ihre Brunnen privatisierte.
In den Neunzigerjahren bekamen die “Conservationist” hunderte von Millionen Dollar an Spenden, sogar von der Weltbank und von umweltschädigenden Multis, u.a. von Ölkonzernen, die sich damit “grünwaschen” wollten. “Das Geld ist das größte Problem,” meinte Mac Chapin, “es unterminiert jede lokale Initiative.” Aber auch die Menschenrechts-Aktivisten benötigen spenden für ihre Arbeit – und müssen ebenso wie die Umweltschützer Erfolge vorzeigen, um weiter an Spenden heranzukommen. Dazu hat sich die Konzentration nahezu aller NGOs auf “Single Point Issues” bewährt. In der wirklichen Welt hängt jedoch alles mit allem zusammen.
Die kalifornische Anthropologin Shirley Strum studierte, ähnlich wie die Schimpansenforscherin Jane Goodall, 14 Jahre lang Paviane – auf einer englischen Rinderfarm in Kenia, die 18.000 Hektar umfaßte. Als diese verstaatlicht wurde und man Kleinbauern auf dem Land ansiedelte, kam es zum Konflikt: Die Paviane plünderten deren Maisfelder. Dabei wurde immer wieder einer der Räuber getötet. “Ich hasste die Bauern,” schrieb Shirley Strum in ihrem Buch “Leben unter Pavianen”. Dennoch bemühte sie sich um Deeskalation. Sie war während ihrer 13jährigen Feldforschung nicht ganz so menschenfeindlich geworden wie ihre US-Wissenschaftskollegin Dian Fossey, die Berggorillas in Ruanda studierte (1).
Die FAZ schrieb über die 1985 von einem US-Kollegen ermordete Forscherin: Ihre Begabung, sich in das Wesen der Gorillas einzufühlen, habe in “extremem Gegensatz zu ihrer Unfähigkeit gestanden, im zwischenmenschlichen Bereich Feingefühl, Diplomatie oder Kompromissbereitschaft zu zeigen”. Shirley Strum erreichte es zusammen mit einem US-Kollegen, den sie später heiratete, dass eine Schule für die Bauern gebaut wurde und man ihnen Landwirtschaftskurse sowie “Wildlife-Erziehungsprogramme” anbot. Zwar änderte sich daraufhin ihre Einstellung gegenüber dem US-Forschungsvorhaben – bis dahin, dass einer der Bauern meinte: “Lieber haben wir Überfälle durch die Paviane und ein Pavian-Projekt, das sie studiert und uns hilft, als keine Paviane und kein Projekt,” aber schließlich mußte die Forscherin mit ihren etwa 120 Paviane doch weichen: 1984 fing sie die Tiere ein und siedelte sie auf dem Gelände einer anderen Farm in Kenia an. Sie selbst kaufte sich mit ihrem Mann ebenfalls eine Farm – in der Nähe der Hauptstadt Nairobi. Ein anderer US-Anthropologe, Robert Sapolsky, erforschte ebenfalls jahrzehntelang Paviane in Kenia. Diese lebten in einem Schutzgebiet, das dann jedoch zerstört wurde – und mit ihm die Pavianhorde. Sapolsky kehrte daraufhin nach Amerika zurück, wo er sich seitdem mit den neuronalen Ursachen von Depressionen befaßt.
Von einer anderen Vertreibung berichtete die in New York lehrende Anthropologin Paige West, die auf Papua-Neuguinea acht Jahre lang Menschen studierte – den Stamm der “Gimi”. Um deren Lebensraum war ferner die US-Naturschutzorganisation “Biodiversity Conservation Network” (BCN)” besorgt. U.a. kartographieren die BNC-Ökologen, ähnlich wie die Geologen früherer Zeiten, die im Auftrag von Staaten und Bergbauunternehmen unterwegs waren, eine “definierte Fläche” im Hinblick auf seine Bodenschätze. Nur dass es hier jetzt im Auftrag von Pharma- und Gentechnik-Unternehmen um lebende Organismen ging. “Ziel von BCN war es”, schreibt Klaus Pedersen, “das soziale Leben der Gimi innerhalb von vier Jahren naturschutzkompatibel umzukrempeln”. Paige West bezeichnete deren Aktivitäten zusammenfassend als eine “neoliberale Herangehensweise an den Naturschutz.” Das Problem bestand nicht darin, dass die Gimis dem Wald, den Pflanzen und Tieren einen anderen “Wert” beimaßen als die Ökoaktivisten von BCN, sondern darin, dass sie diesen “Dingen” überhaupt keinen Wert beimaßen, weil sie sich nicht als getrennt von ihnen begriffen. Pedersen zitiert dazu einen Dorfältesten aus Kamerun: “Der Wald gehört nicht uns. Wir gehören dem Wald. Mó-bele hat ihn als unser Zuhause geschaffen. Wenn wir nicht im Wald leben, wird Mó-bele wütend, weil dies zeigt, dass wir Mó-bele und seinen Wald nicht lieben.”
Statt von einer Ökonomie sollte man ihre Wirtschaftsweise besser als “anökonomisch” bezeichnen, schlug deswegen Jacques Derrida vor. Diese hat auch in anderer Hinsicht Folgen: Eine Mitarbeiterin einer Umweltschutzorganisation, die sich in Laos engagierte, meinte auf der Veranstaltung mit Mac Chapin: “Wir standen unter dem Zeitdruck, dort in fünf Jahren etwas zu erreichen, die Indigenen hatten jedoch ein ganz anderes Zeitkonzept.” Und auch ganz andere Mittel: Ich sprach einmal mit zwei “Health-Officers” aus Papua-Neuguinea, die sich auf Einladung der UNESCO zur medizinischen Weiterbildung in Manila befanden: Sie gewährleisteten die medizinische Versorgung und Gesundheitsprävention in schwer erreichbaren Gegenden, in einem lebten auch ihre Eltern als Subsistenzbauern. Ihr Rang war etwas unterhalb von ausgebildeten Krankenschwestern, man könnte sie als “Barfußärzte” bezeichnen, eingebunden jedoch in ein englisches Gesundheitssystem, das kostenlos war. Einer der beiden “Health-Officer”, er war etwas devoter als der andere, bezeichnete die “Heiler” und “Zauberdoktoren”, die Geld für ihre Behandlung nahmen, als seine “Hauptgegner”, die er bekämpfte, indem er sie als “Betrüger” entlarvte. Während der andere, der souveräner wirkte, bei dem “Hauptproblem” in seiner Region – die Bisse einer bestimmten Giftschlange – sogar die “Heiler” um Unterstützung bat, die in solchen Fällen die Bißstelle mit Lehm und bestimmten Pflanzensäften beschmierten und dazu Zaubersprüche murmelten: “Das hilft fast immer – und ich spare mein teures Serum,” erklärte er mir.
Die Allmende, das Gemeineigentum (oder “Common), das jeder nutzen, aber keiner besitzen darf, wird weltweit immer kleiner, allerdings erstarkt auch der Widerstand – gegen seine Privatisierung (die bis hin zur Patentierung von Zelllinien geht) sowie gegen die Vernutzung auch noch seiner letzten Ressourcen. Das geschieht ebenfalls weltweit. Gleichzeitig wird in den industrialisierten Ländern infolge des Internets die Forderung nach Übertragung der neuen virtuellen Allmenden (freie Software, Linux, Wikipedia) auf die Realökonomie laut. Also auf eine Ausweitung der Kampfzone. Von ihren um Patentschutz und Kopierverbot besorgten Gegnern (Universitäten und Konzernen) werden diese Vorkämpfer einer neuen “Peer-Ökonomie” als (kriminelle) “Netz-Piraten” beschimpft (2). Während umgekehrt die Menschenrechtler und die um freie Nutzung etwa des Saatguts besorgten “NGO”s (Via Campesina z.B.) von “Biopiraterie” sprechen, wenn Konzerne – wie Monsanto, Unilever oder BASF – Anspruch auf Saatpatente anmelden oder das “Wissen ganzer Stämme (um den Nutzen bestimmten Pflanzen z.B.) klauen”, wie der “Planet Diversity”-Kongreß 2008 in Bonn befand. Er wurde von der anthroposophischen “Zukunftsstiftung Landwirtschaft” organisiert, namentlich von Benny Härlin, der zuvor bei Greenpeace arbeitete und früher Hausbesetzer sowie taz-Lokalredakteur war. Heute organisiert er die Kampagnen gegen Genmais-Anbau. Den Begriff der “Biopiraterie” hatte zuvor bereits die indische Ökofeministin Vandana Shiva popularisiert, deren gleichnamiges Buch 2002 auf Deutsch erschien.
Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse so nah ist?! Überall mehren sich die Zwangsnomaden. Und alles kann privatisiert werden – sogar die Sonne und der Wind. In Deutschland wurden einst die Windkraftanlagen gegen die Gebietsschutz beanspruchenden Stromkonzerne und den Staat durchgesetzt – von unten, aber kaum hatten die “local people” das geschafft, wurde ihnen das Geschäft von den selben Konzernen abgerungen, die nun mit internationalem Venture-Kapital von oben den Gemeinden und Dörfern ganze “Windparks” vor die Tür knallen. Im Alten Land bei Hamburg versuchte der Senat und der Airbus-Konzern ein Obstbauerndorf per Gesetz zu enteignen, um die Landebahn für ein neues noch größeres Flugzeug zu erweitern. Auf der Eiderstedter Halbinsel gibt es nicht nur einen Widerstand gegen die meist grünen Naturschützer, die hier laut Aussage des Kehdinger Bauern Schmoldt gegenüber dem Spiegel “das Land beherrschen wie einst die Gutsherren”, sondern auch einen wachsenden Unmut gegen die staatlichen grünen BSE-Maßnahmen – vor allem um die existenzzerstörenden Massentötungen von Rindern zu verhindern .Und in der Lausitz baggert der schwedische Energiekonzern Vattenfall trotz Widerstand ein sorbisches Dorf nach dem anderen ab, jüngst wurde gerade das schönste dort – Horno – “devastiert”.
Die letzten Regenwälder der Welt werden vor allem von Öl- und Gasgesellschaften heimgesucht, meinte Mac Chapin, “die großen Umweltschutzorganisationen bekommen Geld von ihnen – und sagen deswegen nichts zu deren Zerstörungen”. Diese Erfahrung machte er in Brasilien, bestätigt wurde sie von der Kassler Soziologin für Entwicklungsländer Clarita Müller-Plantenberg, die Mac Chapin mit Hilfe ihrer Organisation “Forschungs- und Entwicklungszentrum Chile-Lateinamerika” (FDCL) nach Deutschland eingeladen hatte. Ein im Publikum sitzender Entwicklungshelfer berichtete später von einer ähnlichen Erfahrung in Peru. Zwar gibt es allein in Lateinamerika noch insgesamt 40 Millionen Indigenas, aber viele Völker sind schon so dezimiert, dass die im märkischen Naturschutzgebiet Brodowin von der Biologin Hannelore Gilsenbach redigierte “Zeitschrift für gefährdete Völker – Bumerang” mitunter sogar ihre kleinsten Ausbreitungserfolge für anzeigenswert hält. Im letzten Heft heißt es z.B.: “Die ‘Negrito’-Ureinwohner der Andamanen vom Volk der Onge freuen sich über die Geburt eines Mädchens. Es kam am 9.Juli 2008 in Dugong Creek gesund auf die Welt. Damit stieg die Zahl der Onge auf 98 Menschen.” An anderer Stelle wird vermeldet, dass der kanadische Premierminister sich bei den nahezu zehntausend Ureinwohnern des Landes für ihre jahrelange Mißhandlung durch weiße Erzieher entschuldigt habe: Diese hätten versucht, “den Indianer im Kind” zu töten. Im Gegensatz zur australischen Regierung, die sich bei “ihren” Ureinwohnern nur entschuldigte, sicherte ihnen die kanadische auch noch eine Entschädigung in Höhe von zwei Milliarden Dollar zu.
Ein Zehntel der Fläche Brasiliens und ein Viertel der Fläche von Kolumbien sind als Indigene Territorien und ein Drittel der Mongolei ist als Nationalpark ausgewiesen. “Aber”, wie mir ein Förster und GTZ-Mitarbeiter in der Wüste Gobi, wo der Nationalpark alleine 5,4 Millionen Hektar umfaßt, sagte: “das meiste steht nur auf dem Papier”. Immerhin gelang es der GTZ dort, die Viehzüchter in 80 Kooperativen zu organisieren und in die Nationalparkverwaltung einzubinden. Daneben profitieren diese auch vom neuen Naturtourismus. Bisher mußte noch niemand aus der Gobi mangels einer Erwerbsmöglichkeit wegziehen, dafür nahmen die “Communities” jedoch schon viele Viehzüchter aus anderen Teilen der Mongolei auf, wo sie von großen Bergbauvorhaben vertrieben wurden. Und statt der “Armutswilderei” gibt es im Gobi-Nationalpark heute nur noch gelegentlich eine “Neureichen-Wilderei”.
Die Zerstörung der Regenwälder begann laut Mac Chapin in den Fünfziger- und Sechzigerjahren: Bis dahin hatten Malaria und Gelbfieber noch jedes Kolonisierungsprojekt verhindert: “die Hälfte der Leute starb jedesmal.” Aber dann wurde 1. das DDT entwickelt – und von den amerikanischen Soldaten zum ersten Mal im Krieg gegen Japan eingesetzt, 2. 1947 die Motorsäge erfunden – in Oregon, und 3. Straßenbaugeräte und die Asphaltierung. Dies geschah überall auf der Welt – und bis heute, wobei die medizinischen Mittel immer besser wurden, die Straßenbaugeräte immer größer und die Motorsägen immer mehr. Ein ehemaliger Umweltschützer, der im Publikum saß, ergänzte Mac Chapins Ausführungen dahingehend, dass ein Teil dieser “Errungenschaften” auch den indigenen Völkern zugute komme. In dem Teil Boliviens, wo er arbeitete, hätten sie das dortige Ökoystem allerdings völlig zerstört, allein “weil sie zu viele waren”. (3)
Dieses Problem – der “Überbevölkerung” einer Region – hat Timothy Mitchell thematisiert – am Beispiel Ägyptens. Sein Text “Das Objekt der Entwicklung” erschien gerade auf Deutsch in dem Reader “Vom Imperialismus zum Empire”, den der Afrikanist Andreas Eckert und die Ethnologin Shalini Randeria herausgaben, um zu dokumentieren, wie sich die Globalisierung aus Sicht der Dritten Welt darstellt. In Ägypten waren es Weltbank und IWF, die aus einem Lebensmittel-Exportland mit Hilfe ihrer Agrarexperten ein Getreide-Importland machten, wobei aus dem riesigen “Freiland-Gewächshaus” des Nil-Schwemmlandes armselige Weiden für deutsche Rinderzuchten wurden – und zigtausende von Fellachen in die Städte abwandern mußten. Seitdem sprechen die westlichen Experten dort malthusianisch-zynisch von “Überbevölkerung”. In Vietnam, wo die US-Luftwaffe mit dem Entlaubungsgift “Agent Orange” Ähnliches anrichtete, sprachen US-Soziologen von einer “nachgeholten Urbanisierung”. Während man in China und im Iran die “Überbevölkerung” durch Umwandlung von Weide- in Ackerland und die Ansiedlung von immer mehr Seßhaften auf Nomadenland forciert. Die Mongolen in China fühlen sich bereits auf ihrem eigenen Territorium als Minderheit bedroht, zumal der Staat auch noch ihre Kultur als sezessionistisch angreift.
Die Veranstaltung im Kreuzberger Mehringhof endete versöhnlich: “Menschenrechtler wie Umweltschützer,” so meinte einer aus dem Publikum, “müßten in einen Dialog mit den Vorstellungen und Ideen der Indigenen treten”, bisher hätten sie sich damit noch nie richtig auseinandergesetzt.
Die Mitarbeiter der GTZ-Ökoprojekte in der Mongolei haben das bisher sehr wohl getan – indem sie sich hüteten, “als Experten aufzutreten”. Eine Viehzüchterin aus der Wüste Gobi erzählte mir: “Nach 1990 war jede Familie auf sich selbst gestellt, und sie wanderte so gut wie gar nicht. Das konnte nur durch die Communities gelöst werden. Das sind Kollektive wie im Sozialismus, aber diesmal bestimmen wir selbst, was zu tun ist. Etwas 2000 Viehzüchter haben sich bisher hier zusammengeschlossen. Schon im ersten Jahr 1999 haben wir das Positive daran gemerkt. Nach sieben Jahren können wir nun sagen, dass es richtig war. Wir haben uns kundig gemacht, wie die negative Entwicklung zustande kam. Außerdem haben wir jetzt bessere Möglichkeiten, unsere Produkte zu vermarkten. Wir bekommen bessere Preise für Kaschmirwolle und Leder, die Schafwolle verarbeiten wir selbst. Die Wilderei hat völlig aufgehört und keine Familie sammelt mehr Feuerholz. Wir wissen heute, wie die Natur zu verbessern ist. Außerdem waren wir drei Mal im Ausland, haben viel gesehen und sind auf neue Ideen gekommen. Ich bin selbst ein Beispiel dafür: Obwohl eine einfache Viehzüchterin habe ich mich in den letzten Jahren sehr verändert und mein Leben verbessert. Wir sind 35 Familien, 144 Menschen und haben 7000 Tiere. 1999 ging es nur sechs Familien gut, der Rest war arm. Wir hatte keinen Zugang zu Informationen und waren zerstreut. Heute geht es uns allen gut.”
Die Gobi-Nomaden sind Mitglied in der “World Alliance of Mobile Indigenous People” (WAMIP). Einmal im Jahr treffen sich Delegierte von potentiell allen nomadischen Völkern zu einer internationalen Konferenz, die von der UNESCO gesponsort wird. 2005 fand sie in Äthiopien statt, Gastgeber waren hier die Guji-Oromo, die nahe am “Omo Nationalpark” leben. Ende 2004 hatte die Polizei zusammen mit der Parkverwaltung 463 Hütten der Guji-Oromo niedergebrannt, um die Guji (nomadische Viehzüchter) und Kore (Mais- und Sorghum-Anbauer) aus dem Nationalpark und seiner nahen Umgebung zu vertreiben. Dieser wird von der niederländischen “African Parks Foundation” gemanagt, die den Park zu “einer Attraktion für Dollar-Touristen ausbauen will”, wie die davon Betroffenen in ihrem Bulletin “The Human Cost of Tourist Dollars” schrieben.
Neben einer Kritik an solchen und ähnlichen Vertreibungsaktionen sprach sich der Kongreß der nomadischen Völker für eine Unterstützung des Widerstands der Massai in Kenia aus, die dafür kämpfen, dass ihre Weideflächen, die ihnen einst durch englische Kolonialverträge genommen wurden, für ihre Rinderherden wieder zugänglich sind. Außerdem wurde noch auf die anhaltende Verfolgung der “sea gypsies” (Seezigeuner) in Burma und Indonesien aufmerksam gemacht, deren “Existenz als Kultur und Volk” besonders gefährdet ist. Während es über die burmesischen “Meeresnomaden” einige neuere Untersuchungen von französischen Ethnologen gibt sowie auch einen Dokumentarfilm, werden sie in Indonesien als “Piraten und Verbrecher” begriffen – und seit Auflösung der DDR von der indonesischen Marine mit NVA-Schiffen verfolgt, die ihnen ihre Schiffe abnimmt oder versenkt. Ansonsten waren sich die etwa 120 Delegierten durchaus uneinig, ob sie für die Umwandlung der Weideflächen in Nationalparks oder für eine legale Selbstverwaltung ihrer Territorien votieren sollten, wie es einige Waldnomaden aus Peru forderten. In jedem Fall ging es um “den Erhalt der biologischen und kulturellen Vielfalt”.
Im Herbst 2008 wurde das auf der Konferenz in Barcelona noch einmal in Form einer Deklaration bekräftigt. Obwohl die Naturschützer dies nur begrüßen können, gibt es doch einen gravierenden Unterschied zwischen ihnen und den nomadisch lebenden Indigenen: Während die Nomaden den Raum beherrschen, nehmen die Seßhaften ihn in Besitz, sie zerstückeln und markieren ihn, um ihn aufzuteilen. Zwar hat auch der Nomade Punkte (Wasserstellen, Winterplätze, Versammlungsorte), aber die Frage ist, was ein Prinzip des nomadischen Lebens ist und was nur eine Folge: “die Punkte sind den Wegen, die sie bestimmten, streng untergeordnet, im Gegensatz zu dem, was bei den Seßhaften vor sich geht,” schreiben Gilles Deleuze und Félix Guattari in “Mille Plateaux”. Während der Seßhafte “einen geschlossenen Raum unter den Menschen aufteilt, verteilt der Nomade die Menschen und Tiere in einem offenen Raum, der nicht definiert und nicht kommunizierend ist”. Anny Milovanoff kommt in “La seconde peau du nomade” (Die zweite Haut des Nomaden) zu dem Schluß: “Der Nomade hält sich an die Vorstellung seines Weges und nicht an eine Darstellung des Raumes, den er durchquert. Er überläßt den Raum dem Raum.”
———————————————————————————————————————–
(1) Der holländische Autor Midas Dekkers fragte einmal den Tierfilmer Sir David Attenborough, ob die Primatenforscherin Dian Fossey, mit der Attenborough befreundet gewesen war, nicht zu weit gegangen sei – bei ihrer Verteidigung der Berggorillas gegenüber den von ihr sogenannten Wilderern: “Ja,” antwortete der. “Und sie ging überhaupt zu weit in ihrer Abneidung gegen die Afrikaner. So ließ sie die Bauern in Ruanda wissen, dass sie ihr Vieh nicht im Naturpark weiden lassen durften. Aber es ließ sich kaum sagen, wo der Park begann und endete. Und die armen afrikanischen Bauern hatten nur wenig zu essen. Wenn ihr es doch tut, sagte sie, treffe ich Gegenmaßnahmen. Trotzdem tat es einer von ihnen. Also jagte sie jeder seiner Kühe eine Kugel ins Rückrat. Sie tötete sie zwar nicht, doch sie lähmte sie und raubte dem Besitzer damit Hab und Gut.
Einst verschwand ein Gorillababy. Dian glaubte, zu Recht oder zu Unrecht, dass sie den täter kannte und kidnappte seinen Sohn. Sie band Afrikaner mit Stacheldraht an einen Baum und prügelte sie durch. Das ist keine Art, um die Unterstützung der ansässigen Bevölkerung zu bekommen. Wie auch immer – seit dem Tod von Dian Fossey [sie wurde 1985 ermordet] ist kein einziger Gorilla mehr verschwunden.”
(2) Auf einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin führte der Verteidiger der Wissens-Piraten Lawrence Lessig aus, wie das “andere Amerika” damit umgeht:
Das begann mit “Pistolen und Eisenbahnen”: Mit diesen europäischen Technologien, “die eine vorher nie gekannte Machtfülle in die Hände von Einzelnen legten,” eroberte die amerikanische Bevölkerung einst den Westen. Nun wiederhole sich diese Entwicklung in umgekehrter Richtung: “An der amerikanischen Westküste wurde eine neue elektronische Kultur geprägt. Mit E-Mail, Filesharing und Weblogs verfügt der Einzelne über Möglichkeiten, die früher den Mächtigen vorbehalten waren”. Lessig meinte, vor fünf Jahren hätte sich noch kaum jemand für sein Thema – “Copyrights” – interessiert. Es ging ihm darum, dass die Computertechnologie mit ihren ganzen Remix-Möglichkeiten zwar den Kulturschaffenden neue Freiheiten eingeräumt habe, die Copyright-Gesetze diese jedoch wieder einschränken – und deswegen geändert werden müßten, um nicht ähnlich wie zu Zeiten der Prohibition eine wachsende Zahl von Menschen zu kriminalisieren.
Der “Krieg gegen die Piraten” (Raubkopierer) sei “im Prinzip McCarthyismus: ‘Wer das Urheberrecht in Frage stellt, ist ein Kommunist!’ so drückte sich neulich ein US-Politiker aus.” Das es auch anders geht, beweise Japan: Neben den Manga-Comics” gibt es dort “Dojinshis” – leichte Variationen der Hauptmangas, die von zigtausenden angefertigt und getauscht werden. “Ihr Markt ist eigentlich illegal, diese außergewöhnliche Praxis hat aber eine außerordentliche Kreativität hervorgebracht.” Die amerikanischen Gesetze und die Industrie setzen dagegen alles daran, die Benutzer auf bloße Kosumenten – “Couch-Potatoes” – zu reduzieren: “Wir singen, erzählen, schreiben immer weniger als früher…Es geht mir nicht um Ungehorsam, sondern um eine Reform der Gesetze, um die Kulturproduktion wieder da hinzubringen, wo sie schon einmal war.” So wurde z.B. das Sampling in den USA als illegal klassifiziert: “Die meist schwarzen Musiker brauchen nun Copyrights für jedes Bit. Die Ingenieure meinen zwar, das ist nicht machbar, aber die Anwälte sagen, die Sache sieht vielversprechend aus.”
Der zweite Referent, Peter Baldwin, schien diese Entwicklung sogar zu begrüßen, denn er sah das Problem weniger in der gesetzlichen Einschränkung der Kreativität als in der generellen Erosion des “Privaten” – als dem “Eigentum der Bürger”. Der Musiker Will Rogers sagte einmal “Prohibition ist besser als gar kein Alkohol!” Der Jurist Lawrence zeichne ein zu schwarzes Bild von der Entwicklung. “Nach Lage der Dinge muß die Kreativität eben ein paar Kurven nehmen – es wird immer Hacker geben”. Und dass die neue Freiheit des Internet eingeschränkt wird, stimme auch nicht, “denn es gibt immer mehr Weblogs”. Außerdem müsse man sich fragen, “ob die Kreativität wirklich davon abhängig ist, zitieren zu dürfen: Wenn ich umformulieren kann, brauche ich auch keine Copyright-Anwälte zu fürchten.” Es gehe hierbei um die Natur der Kreativität, die mit der Renaissance als “göttlicher Funke” im Künstler/Wissenschaftler begriffen wurde, diese Idee hätten wir aber längst hinter uns gelassen, heute sei die ganze Wissenschaft eine “große Gemeinschaft – und schon weit weg vom Besitz an Wissen. Was vermissen wir denn aufgrund der strengen Copyrights?” Der im Publikum sitzende “Free-Software-Fighter” Volker Grassmuck vermißte z.B. ein nicht-denunzierendes Wort für “Raubkopierer”, das selbst der Soziologe Dirk Baecker kürzlich noch in seiner diesbezüglichen Studie für den Microsoft-Konzern verwendete. Ein anderer Zuhörer erinnerte in dem Zusammenhang an einen SDS-Beschluß, der ausdrücklich die Raubdrucker ermutigte, sie jedoch gleichzeitig zur Mäßigung ihrer Gewinnabsichten verpflichtete. Mit dem “Kopiergroschen” für Autoren habe man hier später eine quasi-gewerkschaftliche Lösung gefunden – bei den “Xerox-Usern”. Dieser “Freigeist” walte auch heute noch im Europäischen Parlament, insofern es dort – inspiriert von der “Open-Source-Bewegung” und “Linux” – Bestrebungen gäbe, “die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen” einzuschränken. Schon warne die Industrie und die FAZ vor Milliardenverlusten und Arbeitsplatzgefährdung in Größenordnungen. Logisch!
Ein Volk forschend und missionierend unterwegs in die Wegelosigkeit:

Die Linguistin Hella Knappertsbusch in einer Original-Dschungellandschaft
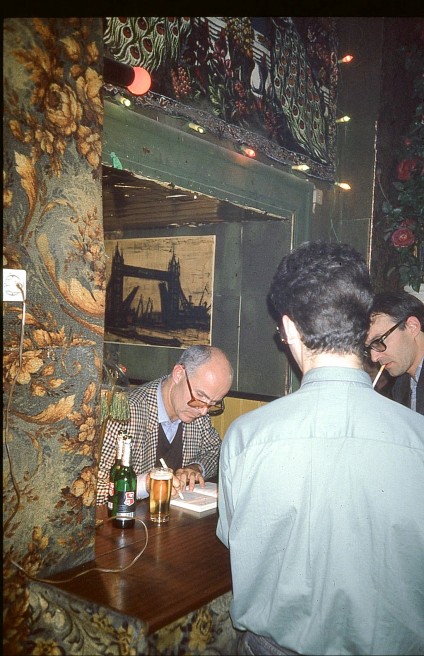
Walter Seitter signiert seine Ethnostudie über die Nibelungen im „Dschungelnest 3000“

Das Ehepaar Wolters aus Friedenau auf dem Weg zum Empfang beim Botschafter von Neu-Guinea

Die Afrikareisenden Elfi und Joachim Rohloff wieder daheim in ihrem gemütlichen Zuhause in Treptow, wo jetzt jede Menge Schreibarbeit auf sie wartet.

Der Lehrkörper des Ethnologischen Instituts der Freien Universität mit ihren zwei Sekretärinnen, Frau Schimanski und Frau Jellinek.

Der Anthropologe Dr. Dietmar Kroll – in einem allzu vertrauten Gespräch mit einer indigenen Informantin

Die Burmistik-Doktorantin Jennifer Bartholdy mit ihrem Kind eines Weißen
Ganze Generationen generieren
„Generieren“ heißt so viel wie „automatisch erzeugen (lat. generare)“, sagt der Wiktionary. Als „Gegenwort“ gilt ihm: „manuell erstellen“. Für den Duden ist „generieren“ ein Synonym für „kreieren“. Auf Englisch heißt das Verb „to generate“ – und ist noch weitgehender anwendbar: von „errechnen“ über vermehren bis „ausarbeiten“ (ein „document“ z.B.). In dem Wort ist das „Genus“ (Plural Genera) – Art, Gattung Geschlecht – enthalten, ebenso das „Gen“, die Genetik. Und damit die Fortpflanzung, die Fruchtbarkeit – das „Errechnen“ von Nachkommen oder Gewinnchancen bzw. Gewinne. Dergestalt wurde „generieren“ fast weltweit zu einem „Magic Word“. In einer Zeit, da täglich nicht nur Arten sondern auch Verben aussterben.
„Die 149 Logenplätze generieren ab 2014 angeblich Einnahmen von rund 70 Millionen Euro,“ heißt es z.B. in der taz über ein Fußballstadion. „Mit ihrer prominenten Besetzung könnte sie aber Aufmerksamkeit generieren,“ schreibt die taz über eine Umweltschutzkampagne. „Social-Media-Ranking-Dienste wie Klout oder Peerindex generieren aus den Kontakten in sozialen Netzwerken einen Wert auf einer Skala von 0 bis 100,“ mit diesen Worten erklärt eine taz-Autorin ein US-Unternehmen, das mit dem Slogan „Entdecke Deinen Einfluss“ wirbt. „Solche Veranstaltungen müssen wir immer wieder generieren,“ sagt eine Museumsleiterin in der taz über ihr gutbesuchte letztes „Event“. Es gelte, „anhaltendes Wachstum zu generieren,“ meint dort ein Ökonom. „Ich habe mich entschieden, Bewusstsein zu generieren,“ behauptet ein Filmer, der einen TV-Spot zur Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ drehte. Auf einer „Cryptoparty“ berichtete eine Frau, sie durchforste Webseiten „nach Daten, aus denen sich Passwörter generieren lassen“. Wer auch immer Suhrkamp übernimmt, er hat „die schier unlösbare Aufgabe, Bestseller zu generieren,“ schreibt ein taz-Literaturbetriebskritiker. „Islands Fischwirtschaft droht nicht nur ein Verkaufsverbot für Makrelen, sondern für alle ihre Fischprodukte. Sie generieren 75 Prozent des isländischen Exportwerts,“ heißt es über den Fischrechte-Streit zwischen der EU und Island in einem taz-Korrespondentenbericht. Eine ehemalige Linke, jetzt Maklerin sagt: „Geld muss nicht immer etwas Negatives sein. Man kann viel über Gentrifizierung schimpfen. Aber: All diejenigen, die jetzt nach Berlin kommen und hier investieren, bringen Geld in die Stadt. Sie generieren Jobs.“ In diesem „Statement“ haben wir das ganze derzeitige Scheißdenken wie in einer Nußschale.
Eine alternative Imkerin gibt zu Protokoll: „Noch seien viele Fragen offen – deswegen gehe sie zum Beispiel auch auf die taz-Genossenschaftsversammlung, um dort Ideen zu generieren.“ Das Verb sickert in alle Bereiche ein – bis in die kubanische Musik z.B.: „verspielte Rhythmen betonen Gemeinsamkeiten und generieren das Beste, das die Bassmusik derzeit zu bieten hat,“ schreibt ein taz-Kritiker. Eine Feministin seufzt: „Frauen können keine allgemeinen weiblichen Erfahrungen mehr generieren…Männer generieren Macht in ihrer Beziehung.“ Ein linker Regisseur erklärt der taz die Hauptfigur seines neuen Films: „Weil er ein Kapitalist ist, kann er nicht anders, als zu denken: das muss ich kaufen, anstatt es aus sich selbst heraus zu generieren.“ Es sich selbst zu schaffen, meint er wahrscheinlich. Und dies im Sinne einer „creatio ex nihilo“ (wie die des Schöpfergottes). Der Regisseur spricht hier der männlichen Prokreation das Wort, also der Vermehrung (durch Herstellung toller Werke), die mehr als die Reproduktion sichern. Beide Wörter gelten jedoch im strengen Sinne nur für die biologische Fortpflanzung, d.h. für das „Egoistische Gen“, wenn man dabei dem Erzdarwinisten Richard Dawkins folgt. Dieser übersetzte damit 1976 Margret Thatchers Dummbeutel-Bekenntnis: „Ich kenne keine Gesellschaft, nur Individuen“ – als ewige Wahrheit in die Natur: Den Genen geht es nicht um die Arterhaltung, sondern um das Individuum, das ihnen aber nur als Transportmittel dient, in dem sie – die Gene – untereinander um ihre Verteilung in der nächsten Generation konkurrieren.
Aus dieser Ecke kommt das Wort „generieren“, erst nach der Wende wurde es in der taz vom Feuilleton übernommen – quasi weichgeklopft, so dass es längst überall paßt, wenn es darum geht, sich Uptodate auszudrücken.

Carla, die Frau des berühmten Krokodilforschers Peter Zeller, wartet am Ufer des Orinoko auf die Rückkehr ihres Mannes (vergeblich?)

Im Vordergrund: eine Gruppe Doktoranten in der unterirdischen Kantine des „Gombe Stream Research Center“ von Jane Goodall; im Hintergrund: drei einheimische Mitarbeiter

Helmut hinter seiner geliebten „Dschungelbar“ am Rande des Krüger-Nationalparks, ein Muß für jeden Safarisauftouristen.

Die drei Töchter der Ethnologen Söderboom, Winchester und Meyerbuer bereiten sich darauf vor, ihre Väter bei der nächsten Feldforschung nach Westafrika zu begleiten – und üben sich schon mal im „Buschskat“, das ohne Karten gespielt wird.
Auch diese zwei sympathischen Primatenforscher aus Pirmasens bereiten sich auf ihre nächste Expedition vor, die sie diesmal bis tief in den Kongo führen wird. Hier sprechen sie gerade während einer Federball-Spielpause ihr Vorgehen dort ab.
Ähnliches gilt auch für die fünf Zeugen Jehovas Magda Meier, Annelotte Friedberg, Hannelore Welsch, Adolf Mittenzweig und Wilhelm Wien, die auf Mission in das Amazonasgebiet gehen. Hier werden sie gerade von ihrer Sprachlehrerin Eleonora Rothenberg verabschiedet, die zwölf einheimische Dialekte auswendig kann und ihnen daneben zuletzt noch so manchen guten „Dschungeltipp“ mit auf den entbehrungsreichen Weg gegeben hat.

Fünf deutsche Entwicklungshelfer in Tansania bei der Abendwäsche in ihrer provisorischen „Feld-Naßzelle“. Der Mann mit Brille ist der für das Wiederaufforstungs-Projekt verantwortliche Oberförster Engelbert Wulffen, ein international anerkannter Fachmann für Harthölzer und Spanplatten.

Die zwei Leipziger Ethologiestudenten, Birgit und Jan, haben sich mit ihrem PKW aufgemacht. Sie wollen die letzten Orang-Utan auf Sumatra retten. Hier legen sie gerade eine kurze Pause auf dem Rastplatz Pfefferhöhe ein. Bis jetzt ging alles glatt.

Der Koch der deutschen Spitzbergen-Expedition, Hinnerk Schwader, in der Kantine der dortigen Forschungsstation bei den letzten Vorbereitungen für eine Kabeljau-Suppe vom Feinsten.