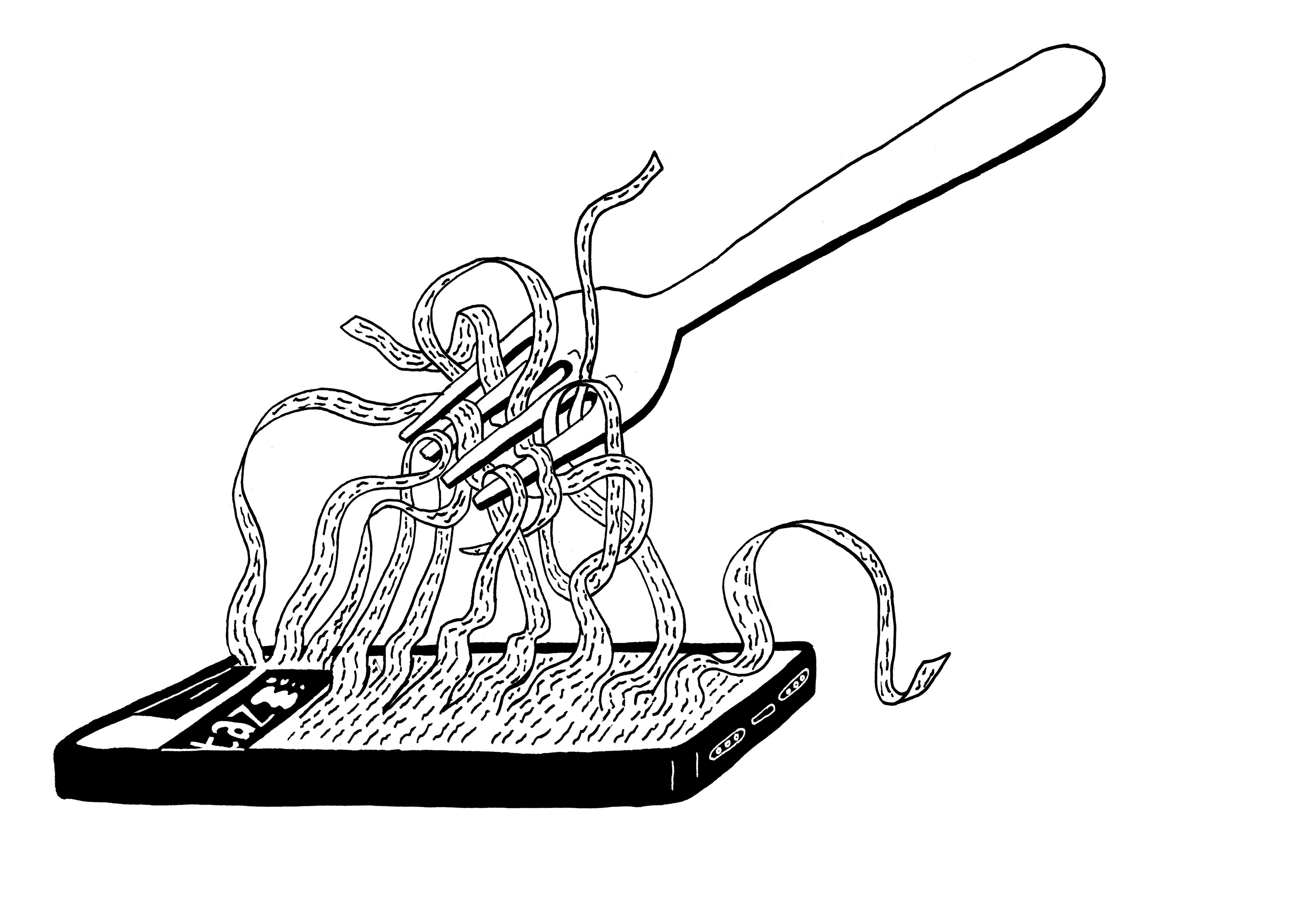Frontstadt. Von dem Comiczeichner Gerhard Seyfried existiert eine Deutschlandkarte aus den Siebzigern, auf der sämtliche Namen der eingezeichneten Städte verballhornt sind: Lynchen, Bankfurt, Dusseldorf. Berlin ist in Rostberlin und Restberlin geteilt. Was auf seine Weise treffend beschreibt, wie die eine und wie die andere Stadt jeweils ausgesehen hat, zumindest aus westlicher Perspektive. Denn ein Auge für die sozialistisch-optimistische Luftigkeit und nüchterne Pracht vieler Neubauten der Hauptstadt der DDR dürften die an bunte Reklamen gewöhnten Westberliner kaum gehabt haben, weshalb ihnen im Ostteil der Stadt vor allem das Rostige, der zerschossen-verschlissen grau-schwarze Putz der Altbauten auffiel. Ganz ähnlich sanierungsbedürftige Altbauten standen auch im Westteil zuhauf, doch bunter umstellt und bewohnt; „Kürüzbürüg“ entstand in und aus Kreuzberg, zum Grusel der betuchteren Leute in den Außenbezirken – abfällige Witzeleien über Türken und, vor allem, über Türkinnen („immer schon den nächsten Braten in der Röhre“) liefen in meiner Grundschule jedenfalls um. Westberlin war Restberlin, eine aus Quartieren und Siedlungen um in der Gründerzeit groß gewachsene Dörfer zusammengeschnürte Stadt ohne eigentlichen Kern, stattdessen mit mehreren Zentren dort, wo es an einem Platz oder einer großen Kreuzung eine U-Bahnstation und ein Warenhaus gab sowie manchmal ein Kino. Als Innenstadtersatz diente die bekannteste der Einkaufsmeilen, der Kurfürstendamm samt einiger angrenzender Straßenecken und Plätze um den Fernbahnhof Zoologischer Garten. Der wiederum als Fernbahnhof winzig war mit seinen gerade mal vier Gleisen, die zwei der S-Bahn in der Nachbarhalle außer Acht gelassen. Das politische Zentrum der Stadt, das Rathaus Schöneberg, lag etwa drei Kilometer südöstlich davon, an einem kleinen, meist mit parkenden Autos zugestellten Platz und dicht an einem Park – ein wuchtiger Bau aus den letzten Jahren der Kaiserzeit und doch nur eines von vielen ähnlich mächtig dimensionierten Rathäusern und Verwaltungsgebäuden der gleichen Epoche. Es führten mehrere Buslinien und eine viel befahrene Straße an ihm vorbei. Insgesamt befand sich in seiner Umgebung wenig, das Leute veranlasst hätte, sich dort umzusehen.
Mein Vater hatte, noch bevor er im April 1961 dreißig wurde, drei Kinder, ein zweijähriges, ein einjähriges und neu geborenes, als er sich entschied, eine Stelle bei einem Bundesamt in Westberlin anzutreten oder, vielmehr, eine ruhige, gut dotierte Laufbahn vom Regierungsrat bis zum Leitenden Regierungsdirektor zu beginnen – wahrscheinlich gab es aufgrund der politischen Lage Personalnot bei der Behörde und für meinen Vater ein entsprechend verlockendes Angebot. Er nahm ein möbliertes Zimmer bei einer älteren Schweizer Dame (die wir später noch manchmal besuchten), trat alle paar Wochen die vom Dienstherren bewilligten Heimreisen an und muss ansonsten für Frau und Kinder weit weg gewesen sein. Bis er, nach bestandener Probezeit, im Laufe des Jahres 1962 eine Wohnung mieten und die Familie nach Berlin holen konnte. Diese erste Wohnung lag in Westend und damit, wie die zweite in Zehlendorf, eher am Stadtrand. Von hier aus fuhren wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie wir sagten, in die Stadt, in den meisten Fällen, um Kleidung oder Schuhe zu kaufen. Wann ich Westberlin abseits bestimmter Einkaufsstraßen kennengelernt habe, kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen.
Ebenfalls nicht mehr sagen kann ich, wann mir die Insellage der Stadt bewusst geworden wäre. Unsere nächsten Verwandten wohnten am Rhein oder auf halbem Weg zwischen Hamburg und Dänemark. Die Fahrt zu ihnen war nicht hauptsächlich deshalb lang, weil wir die DDR durchqueren mussten. Die südliche Stadtgrenze konnten wir mit dem Fahrrad leicht erreichen, sie lag in einem Wald aus Kiefern, Lärchen und Gestrüpp. Wir fuhren als Zehn- oder Elfjährige dorthin, weil es eine Ecke war, in die sich wenige Spaziergänger verirrten und in der es, außer Bäumen und Sandwegen, Bombentrichter, eine demontierte Bahnstrecke und interessante Schilder gab: You are leaving the American sector. Dass hier etwas abgeschnitten, ein Weitergehen oder Fahren unmöglich war, steigerte die Attraktivität des Ortes, es isolierte und entrückte das kleine Stück Landschaft, überließ es sich selbst und völlig in Frieden. Der gleiche Eindruck stellte sich ein, wenn ich später als Jugendlicher oder junger Erwachsener in Westberlin auf die Stadtgrenze stieß, jedenfalls an den Stellen, an denen sie nicht mit Aussichtsplattformen und das Schicksal der geteilten Stadt beklagenden Schildern für den Frontstadttourismus erschlossen war: sich selbst überlassene Winkel, Ruhe, Straßenzüge in die Abgeschiedenheit hinein, manchmal kaum hundert Meter vom dichten Autoverkehr entfernt. Ich habe wenige helle, lichtdurchflutete Bilder von Westberlin im Gedächtnis. Die von der Grenzbefestigung, friedlich im Nachmittagssonnenschein am Ende einer stillen Wohnstraße oder am Rand einer Brache, gehören dazu.
Im Rückblick verstehe ich, woher der Eindruck rührte. Die Grenze machte aus Durchfahrtsstraßen Sackgassen und schuf verkehrsberuhigte Zonen. Westberlin war aus dem Straßennetz um es herum weitgehend herausgeschnitten, ein unwegsamer Streifen umschloss es. Der zugleich verhinderte, dass, umgekehrt, die Automassen aus der Stadt sich in die Umgebung wälzten. Was immer durch Westberlin rollte, röhrte, dröhnte, stank, es war lokaler Verkehr. Die Grenzübergänge, an denen alle ankommenden und wegfahrenden Fahrzeuge anhalten und warten mussten, funktionierten wie Umwandlungstationen vom Fern- zum Nahverkehr und zurück. Nach Westberlin und wieder hinaus ging es nur im Schritttempo.
Wie sehr ich die Mauer deshalb geliebt hatte, wurde mir klar, als sie verschwand. Ich hatte immer am Stadtrand und verkehrsberuhigt gewohnt und quasi über Nacht wohnte ich zentrumsnah und im dichtesten Durchgangsverkehr. Ich nahm edlere Motive, etwa meinen Widerwillen gegen den erstarkenden Nationalismus, für mich in Anspruch, um mit dem Land auch der Stadt, in der ich bis dahin mein Leben verbracht hatte, den Rücken zu kehren. Aber die nationale Welle war in meinem Fall etwas, von dem ich, sicherlich bestürzt und fassungslos, in der Küche sitzend in der Zeitung las oder im Radio hörte; die Menschenjagden und Brandanschläge der Rechten fanden nicht in meiner unmittelbaren Westberliner Umgebung statt. Die Welle der Aggression, die ich dagegen unmittelbar erfuhr, war die des neu entfesselten Autoverkehrs. Bis heute kostet es mich alle Mühen rationaler Überlegungen, aggressive Autofahrer und Neonazis nicht umstandslos und regelmäßig als ein und dieselbe Sorte Mensch anzusehen.
Es war wahrscheinlich nicht zu meinem Schaden, dass ich mir meiner Liebe zur Mauer erst bewusst wurde, als es dafür zu spät war. In unseren Schulatlanten waren die Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 als einzig gültige eingezeichnet, was das Unrecht einer Mauer durch Berlin nur vergrößern konnte. Die DDR gab es nicht, sondern nur, abkürzend wie Bedeutung erheischend, die Zone, von Sowjetisch Besetzte Zone. Über den Namen des lokalen öffentlichen Radiosenders SFB, Sender freies Berlin, werde ich als Heranwachsender kaum nachgedacht haben, auch wenn ich ihn rückblickend als reichlich hochtrabend empfinde. Die andere viel gehörte, lokale Rundfunkstation, das Radio im amerikanischen Sektor (RIAS), trug, was die Freiheit anging, noch dicker auf: „RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt“ wurde dort täglich zum Sendeschluss verkündet. Es lag so viel auftrumpfend Salbungsvolles in diesen Worten, dass es mich als Jugendlichen irritierte und ich es ich ähnlich albern fand wie den theatralisch-ernst Zigarettenrauch einziehenden Cowboy der Marlboro-Kinowerbung. Drüben, wie es ebenfalls voller Untertöne zum obligaten Mitsummen hieß, drüben, jenseits der Mauer war die Zone, war die Unfreiheit und die Mauer war Ausdruck der Zone der Unfreiheit. Es wurde in Westberlin schlicht davon ausgegangen, dass sie bei anständigen Menschen niemals andere Gefühle als Abscheu und Schmerz hervorrufen könne. Es wäre befremdlich und unangemessen gewesen, sie rein als Verkehrshindernis zu betrachten und noch unangemessener, sie dafür zu lieben. Man hätte mich nicht gemocht.
Erhalten hat sich mir aus den Tagen der Frontstadt ein Misstrauen gegen alle, die sich am Klang des Wortes Freiheit hochziehen und berauschen können. In meiner Kindheit und Jugend wurde es vor allem von Leuten im Mund herumgeführt, die sonst auf jeden möglichen Einwand nichts anderes zu sagen hatten als: Geh doch nach drüben! Kein Wunder, dass das Wort Freiheit in meinen Ohren meistens klingt wie ein Synonym für Selbstgerechtigkeit. Ich habe sie oft genug zu hören bekommen, die selbstgerechten Stimmen einer selbstgerechten Welt.