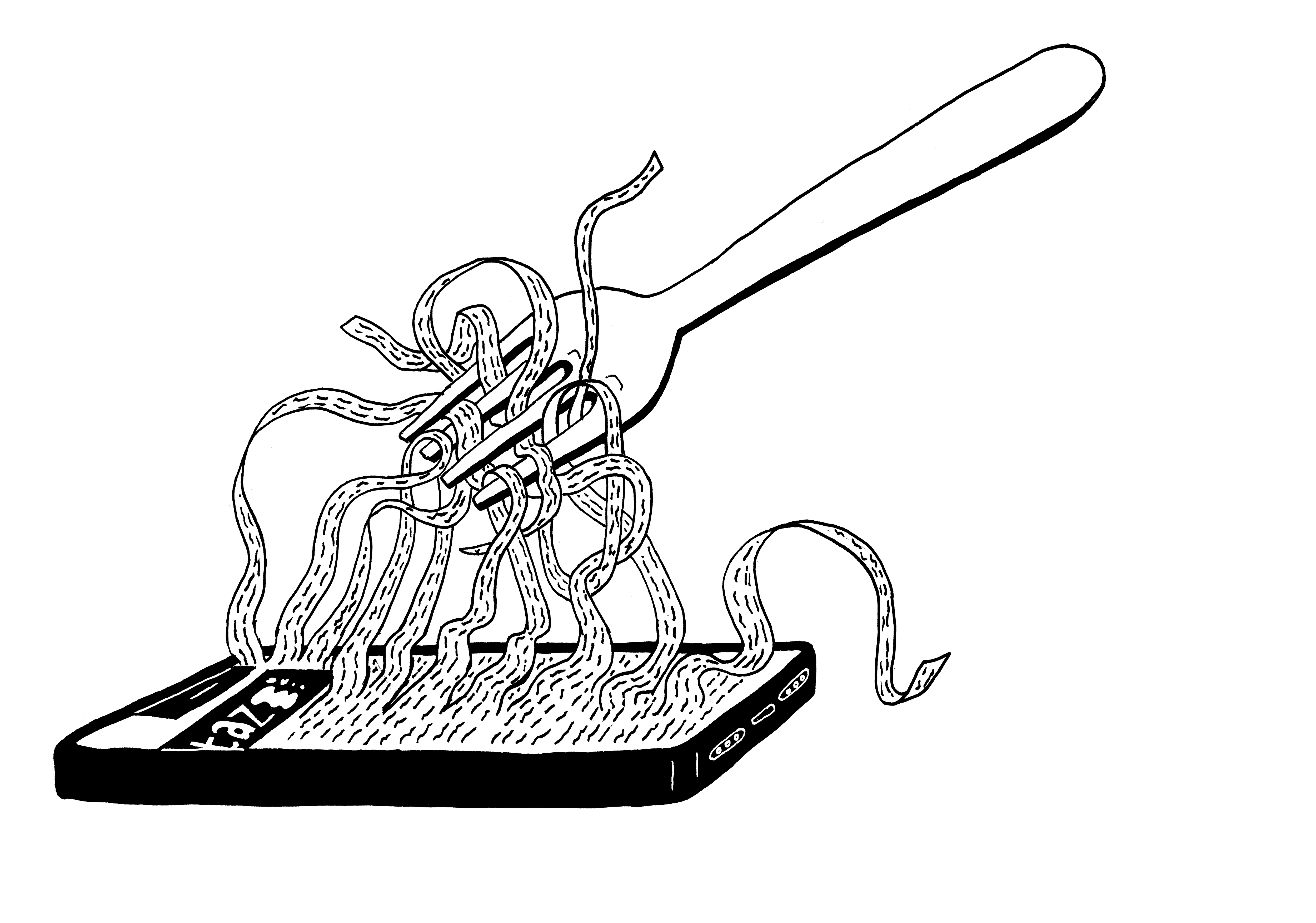Wer die jüngsten Wahlergebnisse in Bolivien besser verstehen will, dem dürfte der Ende 2024 veröffentlichte Tagungsband „Economías populares y capitalismo global“ helfen. 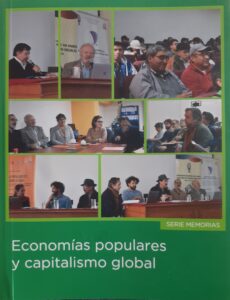 Das Institut für Soziologische Studien der staatlichen Universität San Andrés von La Paz vereinigt darin Berichte von ethnografischen Studien in Bolivien, Brasilien und Mexiko. Hinzu kommen Aufsätze, die im Anschluss an die Tagung vom Mai 2023 geschrieben wurden. Klar wird: Der informelle Sektor ist in Lateinamerika keine ungeregelte Residualkategorie zur Abfederung von Armut, sondern eine im internationalen Handel und für die nationale Politik relevante Größe.
Das Institut für Soziologische Studien der staatlichen Universität San Andrés von La Paz vereinigt darin Berichte von ethnografischen Studien in Bolivien, Brasilien und Mexiko. Hinzu kommen Aufsätze, die im Anschluss an die Tagung vom Mai 2023 geschrieben wurden. Klar wird: Der informelle Sektor ist in Lateinamerika keine ungeregelte Residualkategorie zur Abfederung von Armut, sondern eine im internationalen Handel und für die nationale Politik relevante Größe.
Im ersten Beitrag geht es um die Organisation des informellen Straßenhandels in Mexiko-Stadt und seine korporatistischen oder aber klientelistischen Verbindungen mit dem Staat sowie dem Weltmarkt. Produktive Kleinbetriebe stehen unter dem Konkurrenzdruck importierter Güter, aber der Kleinhandel profitiert davon, schreibt Carlos Alba Vega vom Colegio de México. Gemeinsam seien beiden Bereichen die niedrigen Eingangsbarrieren, aber auch die leichtere Möglichkeit für Frauen, den Einkommenserwerb mit der familiären Sorgearbeit zu verbinden. Mit dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen und dem Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation sei der Handel mit dem asiatischen Giganten in den Mittelpunkt gerückt. Während viele Kleinproduzent*innen als Familien in ihrem Zuhause individualisiert arbeiten, seien die Händler*innen auf öffentliche Räume und eigene Organisationen angewiesen, um ihren Arbeitsplatz in einer rechtlichen Grauzone zu sichern.

Mexiko: Organisation sichert den Arbeitsplatz
Die Sprecher*innen und ihre Straßendelegierten haben dabei eine wichtige Funktion. Ebenso für gegenseitige Unterstützungsleistungen bis hin zu selbst organisierten Kindergärten. Dafür werden von den Verkäuferinnen auch Abgaben gezahlt, je nach Standort in unterschiedlicher Höhe. Überraschend ist jedoch, dass bei einer Vielzahl der im Text genannten Möglichkeiten, eine Leitungsfunktion in der Organisation zu übernehmen, die Möglichkeit einer Wahl durch die Gruppe nicht erwähnt wird. Eher Wahlverwandtschaften, der Einfluss der Regierungspartei, die Ernennung durch die Vorgängerin oder durch bei Konflikten bewiesenes Durchsetzungsvermögen. Auch früher ist es auch zum gewalttätigen Streit über die Kontrolle des Territoriums gekommen. Doch heute kommt das Eindringen der Drogenmafia dazu. Drei seiner Interviewpartnerinnen seien in den letzten Jahren ermordet worden, beklagt der Autor. Der Staat habe wenig Möglichkeiten, das alles zu kontrollieren (siehe auch die umfassende Studie des Autors zusammen mit Marianne Braig).
Im zweiten Beitrag berichtet Nico Tassi, wie früher marginalisierte Gruppen, die „Ameisen der Globalisierung“ (Wanderarbeiter*inne, Wiederverkäufer*innen etc.), in São Paulo, Lima oder La Paz begonnen haben, die Produktionsprozesse und Vermarktungsnetzwerke selbst zu kontrollieren. So werden sie zu wichtigen Akteuren der regionalen Wirtschaft. Darüber hinaus entstehen Geschäftsbeziehungen mit Familien aus China, afrikanischen oder arabischen Staaten. Trotz der Konzentrationsprozesse im globalen Handel könne das Handelsvolumen dieser Familienbetriebe dasjenige großer Einkaufszentren übersteigen.
Dennoch würden sie kaum als wichtige Wirtschaftsakteure wahrgenommen, es sei denn negativ im Zusammenhang mit dem Problem des Schmuggels oder der Ausbeutung in Produktionsbetrieben. Weitgehend unsichtbar sei die Expansion des Kleinhandels mit ähnlichen Akteuren in China. Anders als in Nachbarländern spielten Handelskammern und Diplomatie in Bolivien eine geringere Rolle. Das habe dazu geführt, dass bolivianische Kleinhändler*innen vermehrt selbst zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen und Einkauf nach China fliegen.

„Auto Poma“: Die Erfolgsgeschichte von Eusebio und Zhien
Als Beispiel nennt er Eusebio Machaca aus dem Dorf Calangachi am Titikaka-See an der peruanischen Grenze. Bereits als Jugendlicher habe der Mechaniker begonnen, aus gebrauchten importierten Einzelteilen Fahrzeuge zusammen zu bauen. Anfang des neuen Jahrtausends habe er dann in er chilenischen Hafenstadt Iquique eine Importfirma für gebrauchte Traktoren oder Bagger für den Bergbau gegründet. Dort lernte er Zhien, den Eigentümer einer chinesischen Fahrzeugfirma mit einer ganz ähnlichen persönlichen Geschichte kennen. Zhien lud Machaca nach China ein, um vor Ort zu schauen, welche Fahrzeuge für Bolivien geeignet seien. Eusebio hatte die dort sehr geschätzten Regenbogen-Chilis für Zhien im Gepäck. Und Zhiens Familie übernahm die Patenschaft beim Abitur von Machacas Tochter. Anfangs verkaufte Zhien seine Fahrzeuge noch in Kommission an Machaca. Der nutzte ein Netzwerk von Neffen, Nichten und Patenkindern, um diese auch in anderen Landesteilen Boliviens den Transportkooperativen anzubieten. Mit falschen Rechnungen und ergänzender Barzahlung, die ein hohes Maß gegenseitigen Vertrauens voraussetzen, wurden die hohen Zölle in Bolivien reduziert. Kein Wunder, dass die von Präsidentschaftskandidat Rodrigo Paz Pereira versprochenen Zollsenkungen auf 10 Prozent in diesen Kreisen auf Interesse gestoßen sind.
Weil es aber technische Probleme mit den Fahrzeugen gab, entwickelte Machaca zusammen mit einem chinesischen Ingenieur ein für nicht asphaltierte Landstraßen geeigneteres, billigeres und weniger reparaturanfälliges Modell. Das wurde anschließend unter dem Namen „Auto Poma“ in China produziert, berichtet Tassi. Auch wenn dabei Einzelteile wie der Motor von großen Marken verwendet werden: Die Geschäftsbeziehungen funktionieren direkt und ohne die marktbeherrschenden Firmen. Dabei werden Marktsegmente bedient, die für VW oder Toyota aufgrund der geringen Größe uninteressant sind.

Das Beispiel fügt dem Bild von der zentralistisch, staatlich gelenkten chinesischen Wirtschaft ein neues dezentrales und auf Familienwirtschaft basierendes Element hinzu. Auch aus dem Sektor der Waschmaschinen oder Textilien kann Tassi ähnliche Geschichten erzählen. Wie im Fall von Martha, die in La Paz aber auch Peru und Ecuador ein Netzwerk von Freundinnen, Verwandten und Bekannten geknüpft hat, damit sie für ihre eigenen bescheidenen Mengen an Textilien – Tasso nennt den Marktwert von anfangs 200 US-Dollar – zusammen mit anderen einen Transportcontainer aus China bezahlen konnte. Fehlendes Investitionskapital wird hier durch soziales Kapital wettgemacht.
Weltmarktfirmen wehren sich
Obwohl es sich um Nischen handelt, lässt das alles die Großkonzerne offensichtlich nicht unberührt. 2014 wurden die Poma-Fahrzeuge von der Zollbehörde mit dem Argument konfisziert, sie erfüllten nicht die internationalen Qualitätsstandards, berichtet Tassi. Einen Monat später wurden Ersatzteile wegen zu niedrig deklarierten Preisen beschlagnahmt und eines Nachts die Lager durchsucht. Der Vertreter von Toyota hatte die Verletzung der Markenrechte der eigenen Produkte angezeigt. Tassi hält das Pochen auf Legalität angesichts der Lobbyarbeit der Großkonzerne für den Abbau von Arbeitnehmerrechten und die Reduzierung von Steuern für vorgeschoben. Zumal die klagende Firma gleichzeitig in La Paz in eine rechtlich fragwürdige Umwidmung einer innerstädtischen Grünzone für den Bau eines Kongress- und Handelszentrums verwickelt war (siehe diesen früheren Beitrag auf Latinorama).

Fernando Rabossi kritisiert in einem weiteren Beitrag, wie in Kampagnen für das Urheberrecht und gegen Schmuggel die informelle Graswurzelwirtschaft mit den Geschäften krimineller Mafias im Menschen-, Drogen- und Waffenhandel gleichgesetzt werden. Es sei ein irreführendes Marketingelement von Großkonzernen bei der Sicherung der eigenen Märkte auf Kosten des informellen Sektors.
Chinesen und Chinesinnen in São Paulo
Carlos Freire von der Universität Pará hat die Migrations- und Handelsströme zwischen São Paulo und den chinesischen Metropolen Guangzhou (Kanton), dem Standort von Chinas größter Import- und Exportmesse, sowie Yiwu, dem weltgrößten Markt von Kleinwaren, untersucht. Im Unterschied zu La Paz sind es in São Paulo viele Chines*innen selbst, die die Waren aus ihrem Heimatland vermarkten. „Diese nicht-hegemonische Globalisierung von unten steht nicht im Gegensatz zu der ‚von oben’“, schreibt Freire. Sie laufe jedoch über Akteure, die wegen des geringen eingesetzten Kapitals in den Analysen gewöhnlich nicht berücksichtigt würden. Man finde viele Chines*innen in den sogenannten Galerien, eine Ansammlung vieler Verkaufsboxen im gleichen Gebäude. Die bekannteste die seit 1960 funktionierende Galerie Pagé im Zentrum der Metropole São Paulo. Und Galerien (Einkaufspassagen) zwischen der Straße 25 de Março und Bras seien in den 1970er Jahren mit Hilfe chinesischer Immobilienhändler entstanden, etwa aus Taiwan und Hongkong. Es seien aber keine „China Towns“. Sondern es fänden sich dort auch Verkäufer*innen libanesischer, syrischer, peruanischer oder bolivianischer Herkunft. Wegen hoher Importzölle sei das Geschäft in den Anfangszeiten jedoch zunächst über den Schmuggel aus Paraguay organisiert worden, konkret der Freihandelszone von Ciudad del Este. Das habe sich um die Jahrtausendwende jedoch geändert.
Heute spiele das 1978 gegründete Overseas Chinese Affairs Office der chinesischen Regierung eine wichtige Rolle bei der Unterstützung und Artikulation der Chines*innen in São Paulo und der Förderung der Wirtschaftsbeziehungen. Dies im Zusammenspiel mit einer Reihe dortiger Vereinigungen von Auslandschines*innen, sowie deren Zeitungen und Nachrichtenkanälen. Laut dem Autor gebe es kein anderes Land, außer vielleicht Taiwan, das sich derart intensiv um seine etwa 50 Millionen über die Welt verstreuten Migrant*innen kümmere. Umgekehrt fänden sich zunehmend auch Afrikaner*innen und in geringerem Ausmaß Lateinamerikaner*innen in den Handelszentren Guangzhou und Yiwu, die direkte Handelskontakte auch für Akteure mit wenig Kapital ermöglichen.

Aymara-Kapitalismus
Im ersten der auf die Studien folgenden Essays weist Alfonso Hinojosa auf die kulturelle Prägung der informellen internationalen Handelsbeziehungen der Aymara hin. Statt sich einem kulturell neutralen Kapitalismus hinzugeben, habe der wirtschaftliche Erfolg ihre ethnische Identität noch verstärkt. Das komme unter anderem in den Festen zum Ausdruck, auf denen die Netzwerke erneuert und erweitert werden. Das trage wiederum zum wirtschaftlichen Erfolg und der Verdrängung der bisherigen ökonomischen Eliten bei. Statt nur Gewinne zu produzieren, bildet sich sozialer Zusammenhalt, sprich eine staatsferne Gesellschaft heraus. Dabei schützen die Aymara ihre Märkte vor Konkurrenz von außerhalb. Verwandte werden als Anlaufpunkte in China platziert. Über ihre Vermittlung passen chinesische Unternehmen ihre Produkte wie die Textilmuster auch an die aktuellen Moden auf dem bolivianischen Markt an. Und ähnlich der ländlichen andinen Agrarkultur setzen die Aymara nicht auf Spezialisierung, sondern diversifizieren ihre Produktpalette. So werden ökonomische Risiken verringert, schreibt Hinojosa.
Er zitiert dabei den Ökonomen Carlos Toranzo, der etwas kritischer als die Autor*innen des Tagungsbandes vom Entstehen einer Cholo-Bourgeoisie spricht.

Sie fordere vom Staat Schulen, Gesundheitsdienste und Infrastruktur, die aus den Gewinnen der formal registrierten staatlichen oder privaten Unternehmen und Rohstoffabgaben finanziert werden sollten. Aber aus ihren eigenen Geschäften solle der Staat sich möglichst heraushalten. Als „Estado tranca“ bezeichnet das der überraschend im ersten Wahlgang an der Spitze der Wählergunst stehende Präsidentschaftskandidat Rodrigo Paz Pereira: Der Staat und insbesondere Steuern und Zollbehörde sieht er als Hemmschuh. Und das Versprechen von Steuersenkungen auf 10 Prozent und Bürokratieabbau ging im Wahlkampf mit gleichzeitigen Versprechungen für mehr staatliche Transferzahlungen, Kleingewerbeförderung und Zinssenkungen bei Hausbau- oder Geschäftskrediten einher. Auch wenn Paz Pereira darauf setzt, dass durch Steuersenkungen mehr informelle Akteure motiviert werden, in den formellen Sektor zu wechseln, und damit das Steuervolumen insgesamt zu erhöhen, entspricht sein Angebot doch weitgehend den von Toranzo umschriebenen Erwartungen und mag den Wahlerfolg erklären. (Siehe auch das vorherige Interview über die Ergebnisse der Wahlen in El Alto).
Staatliche Förderung der Schattenwirtschaft…
Wie die staatlichen Stellen derzeit agieren, darüber reflektiert Nico Tassi in einem weiteren Beitrag. In den letzten Jahrzehnten habe der internationale Druck insbesondere aus den USA zugenommen, den informellen Sektor zu bekämpfen. Wegen unlauterem Wettbewerb oder Verletzung der Markenrechte. Im Hintergrund stehe ein Politikwechsel in China, das den informellen Sektor zu einem erwünschten Faktor bei der Sicherstellung der Versorgung im Land und auch seiner Expansionsstrategie gemacht habe.

So sei ein Regierungsvertreter extra nach São Paulo gereist, um gemeinsam mit der Vereinigung der chinesischen Migrant*innen in Brasilien im Nordosten des Landes ein neues 25 de Março zu gründen und nach dem Modell von Zheijang auch neue Produktionsstätten für Kleinwaren aufzubauen. Hinzu kommt die staatliche Behörde für chinesische Belange in Übersee (OACU), die mit den Vereinigungen der Auslandschinesen und Chinesinnen nicht nur Schulen oder Kulturzentren finanziert. Auch Techniktransfer wird gefördert und der informelle chinesische Handel in den Zielländern mit den großen Firmen in Verbindung gebracht. Damit wird die Vermarktung chinesischer Produkte unterstützt. So liegen die Wurzeln des wirtschaftlichen Erfolgs Chinas auf dem Weltmarkt nicht nur in der engen Verbindung zwischen Staat und Konzernen (siehe diese Studie über die bolivianisch-chinesischen Beziehungen), sondern auch in der Einbindung des informellen Sektors, der offensichlich eher als Chance und weniger als Gefahr für den Staat angesehen wird.
…oder die Bekämpfung des informellen Sektors
2002 wurde Brasilien auf die Schwarze Liste der USA gesetzt, schreibt Tassi. Das habe dort Programme zur vorgeblichen „Vitalisierung“ der dank der blühenden informellen Wirtschaft bereits vorher sehr vitalen Innenstadtbereiche zur Folge gehabt. Die Maßnahmen seien nichts anderes als der Versuch gewesen, Territorien wie 25 de Março wieder für kapitalkräftige Unternehmen attraktiv zu machen und ihnen die Kontrolle zu übertragen. Dies geschah selbst unter der Stadtregierung der Arbeiterpartei unter Fernando Haddad. Parallel dazu wurde die Gründung von formalen Kleinunternehmen gefördert. Trotz medialer Kampagnen gegen den informellen Sektor, zeitweiser Schließung der Märkte und selbst Militäreinsatz hätten die Maßnahmen aber nur begrenzte Wirkung gehabt.

Auch in Bolivien hat es eine Politik der Formalisierung gegeben. Etwa durch den systematischen Aufbau von Marktzentren wie dem Mercado Lanza oder dem Camacho-Markt in La Paz. Die wurden jedoch wegen der höheren Standgebühren nur teilweise angenommen. Dies habe wie in Mexiko auch mit dem hohen Organisationsgrad der Händler*innen zu tun, die sich gegen die Verdrängung von der Straße wehren.
Für die Regierungszeit der MAS in Bolivien konstatiert Tassi eine widersprüchliche Haltung. Einerseits würden Händler*innen, der Transportsektor und Werkstätten für die territoriale Kontrolle benötigt und seien dafür instrumentalisiert worden. Andererseits hätte auch die Regierung von Evo Morales versucht, den informellen Sektor einzugrenzen. Etwa durch das Verbot des Imports von Gebrauchtkleidern und älteren Gebrauchtwagen. 2012 wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der es erleichtern sollte, Gelder und anderen Besitz zu beschlagnahmen, der „fiskalisch nicht nachzuvollziehen ist“. Auch dabei waren informeller Handel, Drogenwirtschaft und Schmuggel in den gleichen Topf geworfen worden. Das Gesetz wurde nach massiven Protesten vom Verfassungsgericht einkassiert. Mit staatlichen Produktions- und Vermarktungsbetrieben sollte auch der vermeintlichen Preisspekulation auf den Märkten Einhalt geboten werden. Aber die zuständigen Stellen hätten immer wieder selbst auf die informellen Handelsnetze zurückgreifen müssen, um der Knappheit zu begegnen.
Fehlende soziale Absicherung einer Mehrheit
Im letzten Beitrag des Sammelbandes wird die insgesamt sehr positive Sicht auf den informellen Sektor in diesem Buch etwas relativiert. Santiago Ibarra bezweifelt zwar nicht, dass zahlreiche Personen im informellen Sektor zu Wohlstand gekommen sind.

Er erzählt jedoch die Geschichte der 42-jährigen Juliana. Seit ihrem neunten Lebensjahr war sie erwerbstätig. Sie lebte zeitweise in Santa Cruz, bevor sie wieder nach La Paz zurückkehrte, um unter prekären Bedingungen im Angestelltenverhältnis Essen zuzubereiten und zu verkaufen. Von einem Verwandten bekam sie dann die Chance, einen kleine Verkaufsladen zu übernehmen. Die bescheidene Verbesserung der Einnahmen wurde jedoch mit einem hohen Arbeitsaufwand ihrer Familie (16 Stunden pro Tag) und einer fortbestehenden sozialen Unsicherheit erkauft. Juliana ist nicht sozialversichert und hat bei all ihren Aktivitäten nicht einmal Zeit gefunden, sich im staatlichen Basisgesundheitsdienst registrieren zu lassen. Ausgerechnet die COVID-Pandemie habe ihr jedoch geholfen, den Verkauf etwas ins Laufen zu bringen, da zeitweise der Nahverkehr stillgelegt und nur erlaubt war, im gleichen Viertel einzukaufen. Zu den Verkaufsprodukten gehören zahlreiche Lebensmittel von Weltmarken aber auch nationalen Unternehmen. Weil die Konkurrenz groß ist, die Kaufkraft aber begrenzt, liegt die Gewinnspanne bei gerade einmal 1 bis 2 Prozent des Produktwertes. Damit erzielt der Laden etwa das Doppelte des gesetzlichen Mindestlohns an Einnahmen. Um diese zu verbessern, hat die Familie Kredite aufgenommen und damit einen Gebrauchtwagen gekauft. Damit arbeitet der Ehemann nun als Taxifahrer. Hauptziel von Juliana ist es, ihren Kindern eine bessere Erziehung zu ermöglichen, als sie selbst genossen hat. Wohl auch, weil das eigene Alter keineswegs wirtschaftlich abgesichert ist. Juliana ist vermutlich repräsentativer für den informellen Sektor als die Besitzer*innen der mehrstöckigen Cholets, der Wohn- und Geschäftshäuser im postmodernen andinen Baustil, die zum Markenzeichen der Architektur von El Alto und Symbol neuen Reichtums geworden sind.
Doch ob prekärer Kleinhandel oder Andiner Kapitalismus auf dem Weltmarkt: Für beide Gruppen hat Präsidentschaftskandidat Rodrigo Paz Pereira auch für die Stichwahl attraktivere Versprechen im Angebot, als der ebenfalls marktliberale, aber stärker auf den Unternehmenssektor fixierte konservative Ex-Präsident Jorge Tuto Quiroga. Auch wenn fraglich ist, ob die Versprechen einzuhalten sind.
IDIS, Instituto de Investigaciones Sociológicas ‚Mauricio Lefebvre‘ (Hrsg.), Coloquio Internacional: Economías populares y capitalismo global, Serie Memorias, La Paz 2024