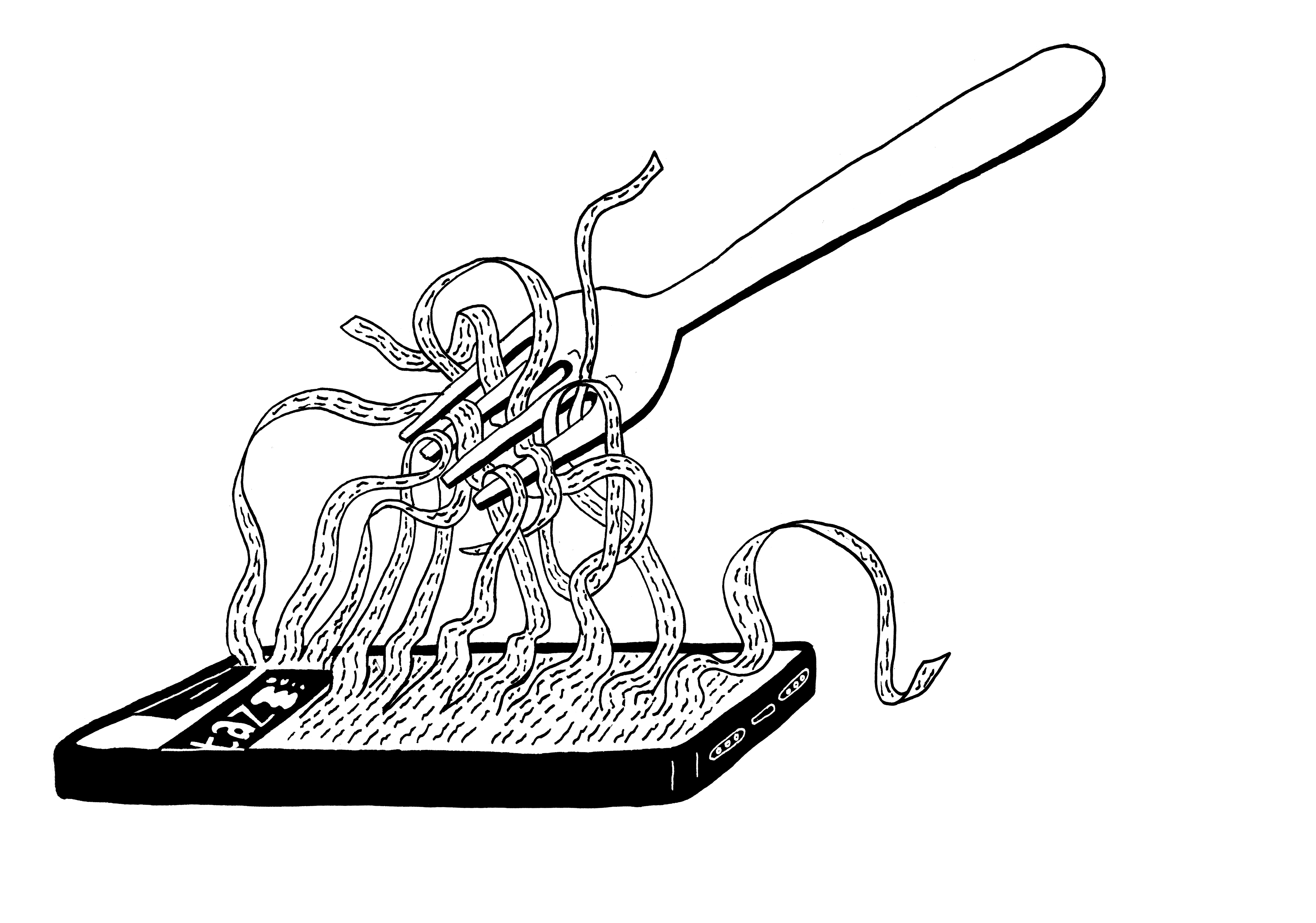Verantwortung kann eine schwere Last sein
Erstmalig spürte ich das Gewicht meiner Aufgabe als examinierte Fachkraft an meinem ersten Arbeitstag in der Notaufnahme. Tags zuvor war ich noch Schülerin gewesen und hatte – wenn auch unbewusst – ein Sicherheitsnetz. Ich durfte in der Theorie nicht einmal ein Medikament verabreichen.
Während der Ausbildung hatte ich bereits den einen oder anderen Notfall miterlebt – auch so manchen Verstorbenen für die Familie hergerichtet, aber gerade einmal zwei Stunden in meiner ersten Schicht als „Examinierte“ traf mich die Tatsache, dass ich absolut keine Ahnung aber viel Verantwortung habe, wie ein Schlag in die Magengrube:
Der schrille Notfallton des IVENA Systems verkündet einen akuten Notfall. SK1.
Männlich,
Mitte 40,
laufende Reanimation,
Ankunft in 12 Minuten.
Meine Kolleg*innen verfallen in geschäftiges Treiben, entscheiden, wer den Notfall betreut und lösen Alarm aus. Per Knopfdruck werden sämtliche notwendigen Fachbereiche informiert. So Praktisch.
Der Kollege, welcher mich an diesem Tag, meinem ersten Tag, im Bereich „innere Medizin“ einarbeitet, nimmt mich zur Seite und erklärt mir, dass ich mit in den Schockraum gehen soll. Nicht zum Helfen, sondern um mich „an das Chaos“ zu gewöhnen. Der Kollege lächelt aufmunternd, ich fühle mich freudig aufgeregt. Eine echte Reanimation, kein alltäglicher Notfall und das am ersten Tag!
Ich Glückspilz.
Ich habe meinen Platz im hinteren Bereich des Schockraums eingenommen. Dort stehe ich (hoffentlich) nicht im Weg und noch besser: Keiner beachtet mich als der Rettungsdienst mit dem Patienten hereinfährt.
Noch nie habe ich einen Menschen mit dieser Hautfarbe gesehen, irgendwo zwischen lila und grau. Seine Augen sind nicht richtig geschlossen und starren ins Leere. Er wird künstlich beatmet und aus seinem Mund läuft ein dünnes Rinnsal an dunkler Flüssigkeit – vielleicht altes Blut, wahrscheinlich Erbrochenes. Sein Brustkorb wird unter rhythmischem Zischen durch einen Roboterarm zusammengedrückt.
Der CPR-Roboter namens LUKAS ermöglicht es uns während einer Reanimation andere Aufgaben auszuführen, zudem ist es weniger anstrengend. Alles sehr praktisch. Alles eine gute Erfindung. Alles um eine besonders effiziente Reanimation zu gewährleisten. Trotz all den Vorteilen ein verstörender Anblick.
Ich kann nicht wegschauen oder mich auf irgendetwas um mich herum konzentrieren.
Langsam verringert sich mein Blickfeld bis ich nur noch den pumpenden Brustkorb, das falsche Hautkolorit und die braune Flüssigkeit, welche langsam am Kinn herunterfließt, wahrnehme.
Alle anderen Geräusche verschwimmen zu einem störenden Hintergrunddröhnen.
Eigentlich bin ich nicht mehr als vollständige Person vorhanden.
In meiner Realität existiert nichts mehr, außer diesem Menschen, der nicht mehr als Mensch zu erkennen ist und mein rasendes Herz. Der Raum stinkt nach Blut, altem Urin und Stuhlgang.
Im Sterben hat der Patient sich entleert. Gefunden wurde er in seinem Auto, niemand weiß wie lange er ohne Puls war. Er ist aber noch so jung, niemand ist bereit ihn ohne Kampf gehen zu lassen.
Zeit verliert ihre Bedeutung, gefühlt bin ich seit Tagen in diesem Raum, wahrscheinlich nur 10 Minuten.
Plötzlich reißt jemand die Tür zum Schockraum auf und für einen kurzen, verwirrenden Moment bin ich mir sicher der Weihnachtsmann ist gerade in diese surreale, außerkörperliche Erfahrung reingestiefelt. Vielleicht ist an diesem Alptraum nichts echt? Vielleicht bin ich nicht total unvorbereitet, überfordert und am dekompensieren, sondern einfach noch am Schlafen? Leider nicht.
Der Weihnachtsmann ist im wahren Leben der Professor, zuständig für die Anlage der ECMO (Herz-Lungen-Maschine). Weisse Haare, weisser Bart, kräftige Statur mit einem selbstbewussten Auftreten. Der letzte Versuch den Patienten zu retten – bisher hat der Patient keinen eigenen Puls.
Mit der ruhigen Autorität, welche nur durch jahrelange Erfahrung kommt, schaut sich der Professor um und verkündet: „Ich brauche eine Pflegekraft des Notfallbereiches nur für mich!“
In exakt diesem Moment wird mir mit stummem Entsetzen, welches nur von absoluter Unfähigkeit kommt, bewusst, dass ich die einzige Person im Schockraum bin, welche die Hände in den Taschen hat. Also tue ich etwas, was ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch öfters nutzen werde: Ich überspiele meine Unsicherheit, meine Panik, meine Angst, alle Selbstzweifel und verkünde: „Das wäre ich, was brauchen Sie?“
Meine Beine sind viel zu schwer, mein Kopf dröhnt – mir ist schmerzhaft bewusst wie unqualifiziert ich für diese Aufgabe bin, ich habe Angst vor der Verantwortung und die Nerven habe ich bereits verloren als der Rettungsdienst angekommen ist.
Der Professor zählt mir motiviert und gut gelaunt – voller Tatendrang – eine lange Liste mit Material auf, welches er benötigt.
Als ich aus dem Schockraum stürze, bin ich erleichtert eine Ausrede zu haben um zu fliehen aber auch sehr zufrieden, dass ich weiß, wo das benötigte Material gelagert wird …
Bis ich auf dem Flur stehe und in meiner Überforderung die Liste schon wieder vergessen habe.
Gelöscht von meinem Gehirn.
Nun stehe ich auf dem Flur, verloren und peinlich betroffen – muss ich echt zurück in diesen furchtbaren Raum und nochmal fragen?
Das Leben eines Menschen steht auf dem Spiel, wie kann ich so unfähig sein? Für einen Moment bleibt mir unter dem Druck meiner Verantwortung die Luft weg.
Im selben Moment läuft ein Student an mir vorbei und fragt, was wir machen.
Ich packe den armen, jungen Mann am Kragen und (wahrscheinlich) brülle in sein Gesicht, dass wir eine ECMO legen wollen, dass Sterilgut, Tücher und irgendwas benötigt wird, aber ich keine Ahnung habe, was es ist, obwohl es meine Verantwortung ist dies zu Wissen!
Und weil es noch Zeichen, Wunder und gute Menschen auf der Welt gibt, lässt er mich nicht stehen, sondern sprintet mit mir in den Operationsraum. Zusammen reißen wir sämtliche Schubladen auf und haben bald einen beachtlichen Stapel an Material zusammen – wir haben beide keine Ahnung, was wir brauchen aber eine Menge Theorien.
Mit meiner Kriegsbeute in den Schockraum zurückkehrend, komplett fertig mit den Nerven und kurz davor einfach ohnmächtig zu werden, bemerkt der Professor erfreut, dass ich mitdenke. Gerade noch so kann ich ein hysterisches Lachen unterdrücken, muss mehrmals schlucken.
Der Professor beginnt mit seiner Arbeit, ich versuche Augenkontakt mit dem starren, leeren Blick des Patienten zu vermeiden. Warum hat die Augen noch niemand zugeklebt? Sieht er mich? Ist er noch dort drinnen? Irgendwo in dieser Hülle?
Irgendwann soll ich ihm etwas steril anreichen und er verkündet freudig „Super, vielen Dank! Das machen Sie ganz toll. Sie und Ich! Wir schaffen das.“
Die ECMO nimmt ihren Betrieb auf, allgemeines Aufatmen für einen Moment und ich bin den Tränen nahe, da ich mich absolut außerhalb meiner Wohlfühlzone befinde.
Dann ist alles vorbei.
Die Ärzt*innen beraten sich, die Sauerstoffsättigung wird nicht besser.
Der Patient ist tot.
Alle Geräte werden abgestellt.
Die Götter in Weiß verschwinden so schnell aus dem Raum, wie sie erschienen sind und lassen uns, die Pflege, alleine mit der Leiche.
Ich bekomme beinahe ein Schleudertrauma von diesen Ereignissen. Kann nicht verstehen, warum jetzt alles umsonst war? Die plötzliche Stille ist so laut, man könnte davon taub werden.
Obwohl ich mich furchtbar fühle, emotional und körperlich ausgelaugt, helfe ich den Kolleg*innen den Raum aufzuräumen, die Leiche sauberzumachen, umzuziehen und in ein Bett zu legen.
Ehrlich gesagt kann ich mich an den Rest des Tages nicht erinnern. Morgens um halb 10 endet meine Erinnerung. Danach ein endloser Strom an Patient*innen und irgendwann konnte ich nachhause. Gegessen habe ich an dem Tag nichts.
Herausstach aber noch wie mein Oberarzt mit der Familie des Verstorbenen umgegangen ist. Er hat den Trauernden nichts von all den Vorgängen im Schockraum berichtet. Nur, dass man alles versucht hat, der Verstorbene aber dann doch selig gegangen ist.
Die Wahrheit ist manchmal eine Bürde, die wir bereit sind alleine zu tragen
Ein schönes Bild, etwas mit dem die Angehörigen leben können.
Sie sehen nicht die Wunden, die Löcher von den Schläuchen, die Zugänge. Sie wollen den Horror nicht hören, wollen es nicht so genau wissen. Ihnen ist vielleicht nicht mal bewusst, dass sie es nicht in allen Einzelheiten wissen möchten, dennoch ist dem so. Niemand möchte den geliebten Menschen so in Erinnerung haben.
Auch diese Informationen können eine Person nachhaltig traumatisieren, Sekundärtrauma nennt sich das dann.
Da habe ich verstanden, dass meine Verantwortung nicht nur auf das „Retten“ begrenzt ist, sondern auch auf das Aufrechterhalten der menschlichen Würde. Sogar über den Tod hinaus.
In der Notaufnahme liegt es in unserer Verantwortung Menschen am schlimmsten Tag ihres Lebens zu unterstützten.
Als Fachpersonal kennt man die Frage: Was ist das Schlimmste, das du je gesehen hast. Wir lachen, weil das von uns erwartet wird und unterhalten den Fragesteller mit einer Anekdote. Dies wird beinahe niemals die wahre „schlimmste Sache“ sein und die Kinder erwähnen wir generell nie.
Irgendwann versteht man die Verantwortung, das Umfeld zu schützen.
Die echten letzten Momente, die echten letzten Worte, die Realität der vielen versäumten Gelegenheiten.
Funktionieren lernen
Gerade wegen unserer Verantwortung, in einer Notsituation wissen zu müssen was zu tun ist, dafür setzen wir uns immer wieder diesen Situationen aus, wieder und wieder und wieder … lesen Richtlinien, Handlungsvorschriften und Fachbücher.
Bekommen eine „dicke Haut“, die Seele bekommt eine Hornhaut – manchmal verlieren wir sie komplett. Unsere Menschlichkeit, unsere Empathie. Geopfert für die optimale Versorgung von fremden Menschen die unsere Namen nie lernen werden, die uns oft nicht mal respektieren.
Nach zwei Jahren haben meine Hände aufgehört zu zittern, nochmal zwei Jahre später konnte mich nichts mehr aus der Ruhe bringen (außer Geburten, aber das ist eine andere Geschichte). Und ich wusste welche Worte zu wählen sind, um eine tragische Situation bestmöglich zu kommunizieren.
Und erst beim Schreiben dieses Artikels ist mir bewusst geworden, dass der Professor ganz genau wusste, dass ich am Ausflippen war, den Tunnelblick hatte und gerade am Rande einer Panikattacke stand. Natürlich wusste er es. Ich sehe es meinen jüngeren Kolleg*innen heute ja auch genau an. Ich bin im Endeffekt, nach langem Überlegen, sehr dankbar für sein Verhalten an diesem Tag. Ohne ihn wäre ich vielleicht aus diesem Raum gegangen und nie wieder gekommen.
Dieses Wissen könnte ein Leben retten:
Infos zu Herzinfarkten finden Sie hier.
Infos zu Schlaganfällen finden Sie hier.
Infos zu einer Lungenembolie finden Sie hier.
In Notfällen ist es immer gut und richtig den Notruf unter 112 zu wählen, bei Unsicherheit zu den eigenen Symptomen kann auch die 116 117 weiterhelfen.