Der Debütroman von Édouard Louis, „Das Ende von Eddy“, ist von explosiver Ehrlichkeit und schon deswegen Dynamit für die zeitgenössische Literatur – über soziale Wahrheit, Scham und Konfrontation
Im amerikanischen Exil und nach 1948 in der DDR hat Bertolt Brecht, wie es heißt, in Gesellschaft gerne eine Parabel erzählt, die er irgendwo aufgeschnappt hatte. Demnach ist ein Vater mit seinem kleinen Sohn spazieren. Als sie an einer Mauer ankommen, die etwa zur Schulter eines erwachsenen Menschen reicht, schlägt der Vater seinem Sohn vor, diesen auf die Mauer zu heben, damit er auf ihr gehe. Der Kleine hat zunächst Angst. Der Vater erkennt den Widerwillen seines Sohnes, der seine Wangen fallen lässt. So kniet er sich in Augenhöhe zu seinem Sohn und spricht zutraulich: „Hab keine Angst. Ich bin ja da.“ Von den Worten des Vaters ermutigt, ziehen sich die zarten Wangen des Kindes unter den Augen zusammen und er nickt. Der Vater hebt ihn also auf die Mauer. Nachdem der Kleine einige Meter stolz über die Mauer geht, stolz, weil er seinem Vater Mut bewies, sagt der Vater ihm: „Spring, Mutter wartet daheim!“ Der Kleine möchte aber nicht springen. Er möchte, dass der Vater ihn mit den Armen von der Mauer nimmt. „Nun spring“, wiederholt der Vater, „Ich werde dich auffangen!“ Der Kleine zögert. Als er jedoch die ausgestreckten Arme des Vaters unter sich sieht, fasst er seinen Mut wieder zusammen und springt. Entgegen der Erwartung des Kindes zieht der Vater die Arme, während die Füße des Kleinen die Mauer verlassen, zurück. Der Kleine fällt auf den Boden und weint. Der Vater steckt die Hände in die Hosentasche und sagt dem Kleinen: „Jetzt hast du was für das Leben gelernt Kleiner. Traue niemandem, der dir seine Hilfe anbietet!“ Mit diesem Satz schloss der alte Brecht seine Parabel. Der Gesellschaft blieb das Wort im Hals stecken, nur einem nicht: Bertolt Brecht, dem großen Humoristen, der vergnügt lachte.
Die Welt von Eddy, der als Arbeiterkind in der Picardie Nordfrankreichs in irgendeinem Kaff, wie man sagen würde, aufwächst und allmählich seine Homosexualität entdeckt, ist vergleichbar mit der Welt, die Brecht in dieser Parabel beschreibt. Sie hat nur den brutalen Unterschied, dass es einen solchen Vater nicht gibt, der seinem Sohn unvergesslich lehrt, niemandem zu trauen. In der Welt von Eddy gibt es nicht einmal was zu lachen, wahrscheinlich nicht einmal für Brecht. Da wirst du gegen Mauern geschlagen oder von Mauern gestoßen – ob du willst oder nicht. Lernen musst du selbst, musst du allein, im Schoss der allgegenwärtigen Klassengewalt.
Auf der Suche nach sozialer Wahrheit
Schon die erste Seite des Romans von Édouard Louis beginnt mit erschütternder Ergriffenheit: „An meine Kindheit habe ich keine einzige glückliche Erinnerung. Das soll nicht heißen, ich hätte in all den Jahren niemals Glück oder Freude empfunden. Aber das Leiden ist totalitär: Es eliminiert alles, was nicht in sein System passt.“
Édouard Louis erzählt in seinem Debütroman, den er gerade einmal mit 22 Jahren veröffentlicht hat, von dieser Kindheit, die seine Kindheit ist. Er beschreibt nüchtern und selbstbewusst das Elend der Verhältnisse in einer Gemeinde in Nordfrankreich. Zwar handelt es sich dabei um seine Kindheit, aber die Form, die seine Erfahrungsschichten zum Ausdruck bringt, ist keinesfalls autobiografisch oder autoanalytisch. Sie ist literarisch, ohne zu literarisieren, d.h. die sedimentierten Erfahrungsschichten von Édouard Louis sind nicht ins Literarische über-setzt, sondern ver-setzt, also transponiert. Anders, so möchte ich die Vermutung anstellen, wäre Louis nicht imstande dazu gewesen, die Totalität der Wahrheit seiner unerträglichen Kindheit als homosexuelles Arbeiterkind sichtbar zu machen. Er hätte nolens volens Lügen müssen. Aber die Lüge ist Louis Sache nicht. Denn wie unschwer aus der Drastik seiner Sprache zu erkennen ist, hat er begriffen, dass wer Wahrheit sucht, nicht nach Glück fragen darf, und wer nach Glück sucht, nicht nach Wahrheit fragen darf. Louis interessiert nur die Wahrheit, so sehr, dass man sich als Leser fragt: Wie viel Wahrheit kann der Mensch vertragen?
 Dieser junge, französische Schriftsteller, der 1992 geboren ist, ist nicht nur ein Glücksfall für die Literatur, die schon lange auf ihre Entfesselung wartet. Louis ist auch ein Glücksfall für die Arbeiterkinder meiner Generation. Unsere Realität wird gerne ausgelöscht hinter dem Leben von Bourgeoisie-Kindern, die ihr vogelleichtes Dasein als Hipsters zelebrieren, sich mit postmoderntypischem Relativismus und reaktionärem Toleranzgelaber schmücken und sich letztlich mit stolz >Generation Y< charakterisieren lassen; stolz, weil sie verantwortungslos macht. Was dabei ausgelöscht wird, ist, dass meine Generation auch in Klassen geteilt ist, weil sie im Schoss der Klassengesellschaft wächst. Es gibt sowas wie Klassenrealitäten. Im Grunde genommen erzählt Louis von diesen Klassenverhältnissen, sowohl aus klassenimmanenter als auch klassenexklusiver Sicht, den Blick von unten zur Seite und dann nach oben gerichtet. Darin liegt die Stärke und der Mut dieses Romans, und auch die Sprachgewalt. Hier wurzelt die Verwandtschaft mit Didier Eribons Rückkehr nach Reims, das, eben weil es sich mit der revitalisierenden Handhabbarmachung des Klassenbegriffs auszeichnet, wie ein Kommentar zu Eddy gelesen werden kann. Louis hat nicht grundlos seinen Debütroman seinem Freund und Lehrer Didier Eribon gewidmet. Gemeinsam lesen sie die Spuren der Klassengewalt auf, die ihre Verwüstungen und Massaker in den unteren, arbeitenden Klassen hinterlässt.
Dieser junge, französische Schriftsteller, der 1992 geboren ist, ist nicht nur ein Glücksfall für die Literatur, die schon lange auf ihre Entfesselung wartet. Louis ist auch ein Glücksfall für die Arbeiterkinder meiner Generation. Unsere Realität wird gerne ausgelöscht hinter dem Leben von Bourgeoisie-Kindern, die ihr vogelleichtes Dasein als Hipsters zelebrieren, sich mit postmoderntypischem Relativismus und reaktionärem Toleranzgelaber schmücken und sich letztlich mit stolz >Generation Y< charakterisieren lassen; stolz, weil sie verantwortungslos macht. Was dabei ausgelöscht wird, ist, dass meine Generation auch in Klassen geteilt ist, weil sie im Schoss der Klassengesellschaft wächst. Es gibt sowas wie Klassenrealitäten. Im Grunde genommen erzählt Louis von diesen Klassenverhältnissen, sowohl aus klassenimmanenter als auch klassenexklusiver Sicht, den Blick von unten zur Seite und dann nach oben gerichtet. Darin liegt die Stärke und der Mut dieses Romans, und auch die Sprachgewalt. Hier wurzelt die Verwandtschaft mit Didier Eribons Rückkehr nach Reims, das, eben weil es sich mit der revitalisierenden Handhabbarmachung des Klassenbegriffs auszeichnet, wie ein Kommentar zu Eddy gelesen werden kann. Louis hat nicht grundlos seinen Debütroman seinem Freund und Lehrer Didier Eribon gewidmet. Gemeinsam lesen sie die Spuren der Klassengewalt auf, die ihre Verwüstungen und Massaker in den unteren, arbeitenden Klassen hinterlässt.
Sylvian, ein „echter Kerl“, ein Menschenopfer
Das Ende von Eddy, 2015 auf deutsch erschienen, ist ein Bericht von einer Flucht. „Ich musste fliehen“ springt dem Leser an entscheidenden Stellen der Geschichte ins Gesicht. Diese Flucht ist keine Flucht von einem Land ins andere. Sie ist auch nicht eine Flucht vor der Familie oder vor bestimmten Personen. Diese Flucht – das weiß der Ich-Erzähler sehr gut – ist die Flucht vor der eigenen sozialen Klasse, wohin sich die Klassengewalt vertikal von oben nach unten herunterschraubt und absetzt, um dort die Besiegten noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal zu besiegen und kaputtzuschlagen.
So erzählt Louis von der Gebrochenheit seines Vaters, der aufgrund eines Unfalls in der Fabrik nicht mehr zu arbeiten imstande ist, vom Alkohol zerstört wird und sich von seinem Sohn verprügeln lässt, weil er seine Kinder nicht schlagen will, wie sein Vater es ehedem mit ihm und seinen Geschwistern gemacht hat. Auch erzählt Louis von seiner Mutter, die zwischen den Grabenkämpfen der Gewalt steht und nicht mehr arbeitet, arbeiten kann, seit sie Mutter geworden ist. Daneben taucht auch die Schwester auf, die als Schülerin den Wunsch hatte, Lehrerin zu werden, und schließlich wie alle anderen Mädchen ihrer Gemeinde auch Kassiererin wurde, wozu sie in der Berufsberatung im Arbeitsamt ständig hingewiesen wurde, bis sie die Lüge, dass sie ja etwas machen müsse, was Mädchen nun einmal machen, gefressen hatte. Hier und da erzählt Louis auch von der Gewaltbereitschaft seiner Mitschüler, deren physischen wie mentalen Schlägen er ausgesetzt war.
Doch was am stärksten Eindruck bei mir hinterlassen hat, war die Erzählung von Sylvian, dem „in unserer Familie allgemein bewundertem Cousin, der zehn Jahre älter als ich, ein echter Kerl“ war. Ein echter Kerl war er, weil er „die meiste Zeit seiner Jugend“ Mopeds stahl, Einbrüche organisierte, Gebäude beschmierte, Briefkästen in die Luft sprengte, mit Drogen dealte, betrunken Auto fuhr(, während seine Kinder auf der Rückbank saßen) und mehrmals verhaftet wurde. Sylvian war bei der Großmutter aufgewachsen, nachdem der Mutter das Sorgerecht vermutlich wegen Alkoholsucht entzogen wurde. Der Vater war nicht bekannt. Nach einigen Anekdoten über Sylvians rastlosem Leben, das sich in derselben Einöde als die Wiederkehr des Immergleichen zeigte, wurde er nach einem schwerwiegenden Delikt für längere Zeit ins Gefängnis gesteckt. Aufgrund „guter Führung“ durfte er an einem Wochenende seine Familie besuchen. Sylvian indes wollte nicht nur seine Familie besuchen; er beschloss, nicht mehr zurück ins Gefängnis zu kehren. Seiner Großmutter, von der wir diesen Bericht in direkter Rede erfahren, hatte er das gesagt. Als sie fragte, ob er sich sicher sei, antwortete Sylvian: „Ja, Oma, denn wenn ich jetzt dahin zurückgehe, dann siehst du mich nie wieder, garantiert.“ Sylvian, dieser „echte Kerl“, war geschlagen. Anders als in Streifen aus dem Kanon westlicher Filme wurde er jedoch durch ein verkapptes Spiel der örtlichen Polizei erwischt – besoffen, am Steuer, völlig unspektakulär. Nun möchte ich Louis weiter erzählen lassen:
„Sylvian betrat den Gerichtssaal. Er wirkte sehr gefasst, wie schon bei der Festnahme durch die Polizei. Weniger erregt, als es denkbar gewesen wäre und als er es früher oft gewesen war. Der Staatsanwalt kam mit den üblichen Fragen: Warum er das getan hatte, warum auf diese Weise, dazu Fragen nach seiner Vergangenheit, seinen Kindern, seinem Privatleben >Und glauben Sie, die Tatsache, dass Sie Ihren Vater nie kennen gelernt haben und dass Ihre Mutter Sie weggegeben hat, hat in irgendeiner Weise mit zu den Gesetzesverstößen geführt?< Dann kamen weitere Fragen, die er nicht verstand, nicht nur wegen des Juristenjargons, sondern weil sie aus Welten stammten, in denen die Leute studierten >Würden Sie die Ansicht vertreten, Ihre Handlungen wären äußeren Umständen anzulasten, oder leben Sie in dem Empfinden, dass einzig Ihr freier Wille in dieser Sache wirksam ist?< Mein Cousin stotterte, er habe die Frage nicht verstanden, und bat, sie zu wiederholen. Es war ihm nicht peinlich, und er spürte auch nicht unmittelbar die Gewalt, die ihm der Staatsanwalt mit seiner Redeweise antat, jene Klassengewalt, die ihn aus der Welt der Schulbildung ausgeschlossen und ihn durch eine Verkettung von Ursache und Wirkung bis hierher, vor Gerichte gebracht hatte. Im Gegenteil, er dachte wahrscheinlich, der Staatsanwalt rede komisch daher. Wie eine Schwuchtel.“
Was folgt: „Sylvian wanderte wieder ins Gefängnis, sechs Jahre brummten sie ihm auf. Und dann wurde Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium festgestellt. Er verweigerte jede Behandlung. Eines Morgens fand man ihn tot in seiner Zelle auf. Er war keine dreißig Jahre alt geworden.“
Wovon Louis hier berichtet, ist, neben der Klassenjustiz, das zeremonielle Klassenritual eines Menschenopfers, eines Arbeiterkindes, das von der herrschenden Klasse ermordet wird – die Prosa des Alltags eben.
Scham als Methode einer konfrontativen Literatur
Édouard Louis hat vor einigen Monaten an der Freien Universität Berlin eine Antrittsvorlesung gehalten. Darin bringt er ein literarisches Programm in Stellung, das an die Tradition engagierter Literatur knüpft. Er zitiert Sartre und verweist auf Émile Zolas Germinalüber die Arbeitskämpfe von französischen Kohlearbeitern. Allerdings nennt er seine eigene Literatur nicht engagierte, sondern >konfrontative Literatur.< Ihm ginge es nämlich darum, den Leser mit einer Realität zu konfrontieren, von der er zwar weiß, die er aber gerne verdrängen möchte. Womit will er die Leser konfrontieren? Er wolle Scham verbreiten, und dafür müsse Literatur kämpfen.
Was Scham ist, brauche ich hier nicht zu untersuchen, obwohl ich sehr dazu geneigt bin. Was aber Scham bewirkt, das kann hier erwähnt werden.
Karl Marx schrieb im Zusammenhang mit der „Hohlheit unseres Patriotismus“ in den Briefen aus den deutsch-französischen Jahrbüchern, worin er bekundet, dass man sich für Deutschland schämen und die Patrioten aus dem Land vertreiben müsse: „Was ist damit gewonnen? Aus Scham macht man keine Revolution. Ich antworte: Die Scham ist schon eine Revolution; […]. Scham ist eine Art Zorn, der in sich gekehrte. Und wenn eine ganze Nation sich wirklich schämte, so wäre sie der Löwe, der sich zum Sprunge in sich zurückzieht. Ich gebe zu, sogar die Scham ist in Deutschland noch nicht vorhanden; im Gegenteil, diese Elenden sind noch Patrioten.“
Wenn also Louis den Leser mit Scham konfrontieren will, so will er, dass die Literatur dafür kämpft, den Zorn des Lesers in ihm zu ihm zu kehren, damit der Leser sich sprungbereit macht. Das gelingt ihm mit seinem Debütroman, vor allem, weil er von explosiver Ehrlichkeit ist. Das Besondere seines Romans liegt darin, dass er schildert, wie die Klassengewalt nicht nur mit besonderer Härte den Homosexuellen erfasst, weil er homosexuell ist, sondern mit ihm seine ganze Mitwelt und die Menschen um ihn herum attackiert. Der Satz „Das Verbrechen besteht nicht darin, etwas zu tun, sondern etwas zu sein“ dehnt sich so durch seine Homosexualität hindurch über die ganze Arbeiterklasse aus. Eddy ist eines der wichtigsten und besten Romane unter der zeitgenössischen Literatur.
Wirklich, ich lebe in beschämenden Zeiten!
*Titelbild: ©Christopher Olssøn / Bild im Text: Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen



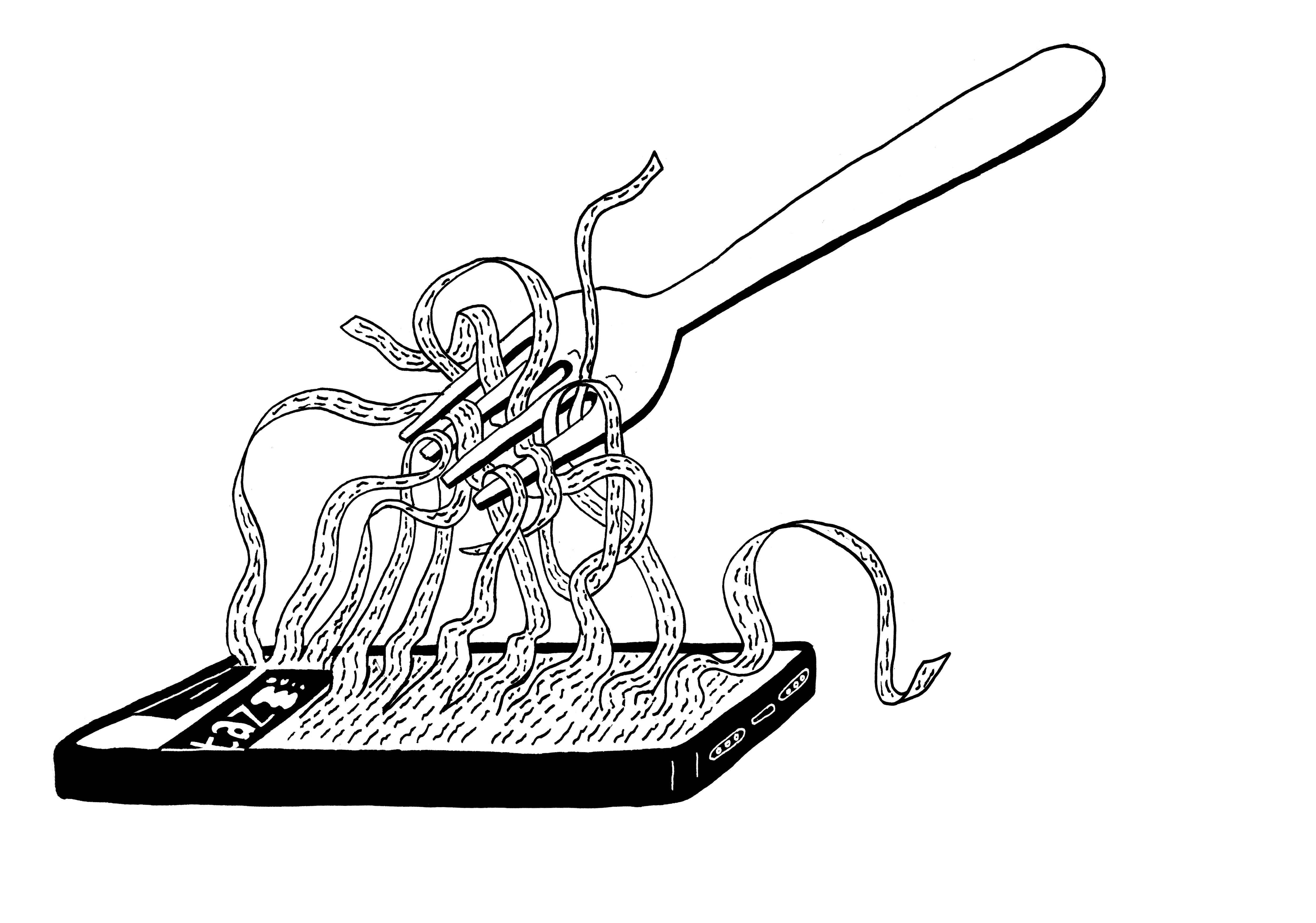
[…] uns täglich an. Darin spottet unser Dasein unserem Selbst. Die Rede ist von Didier Eribon und Édouard Louis. Beide beziehen die literarische Technik und das literarische Rüstzeug, die sie in den Stand […]