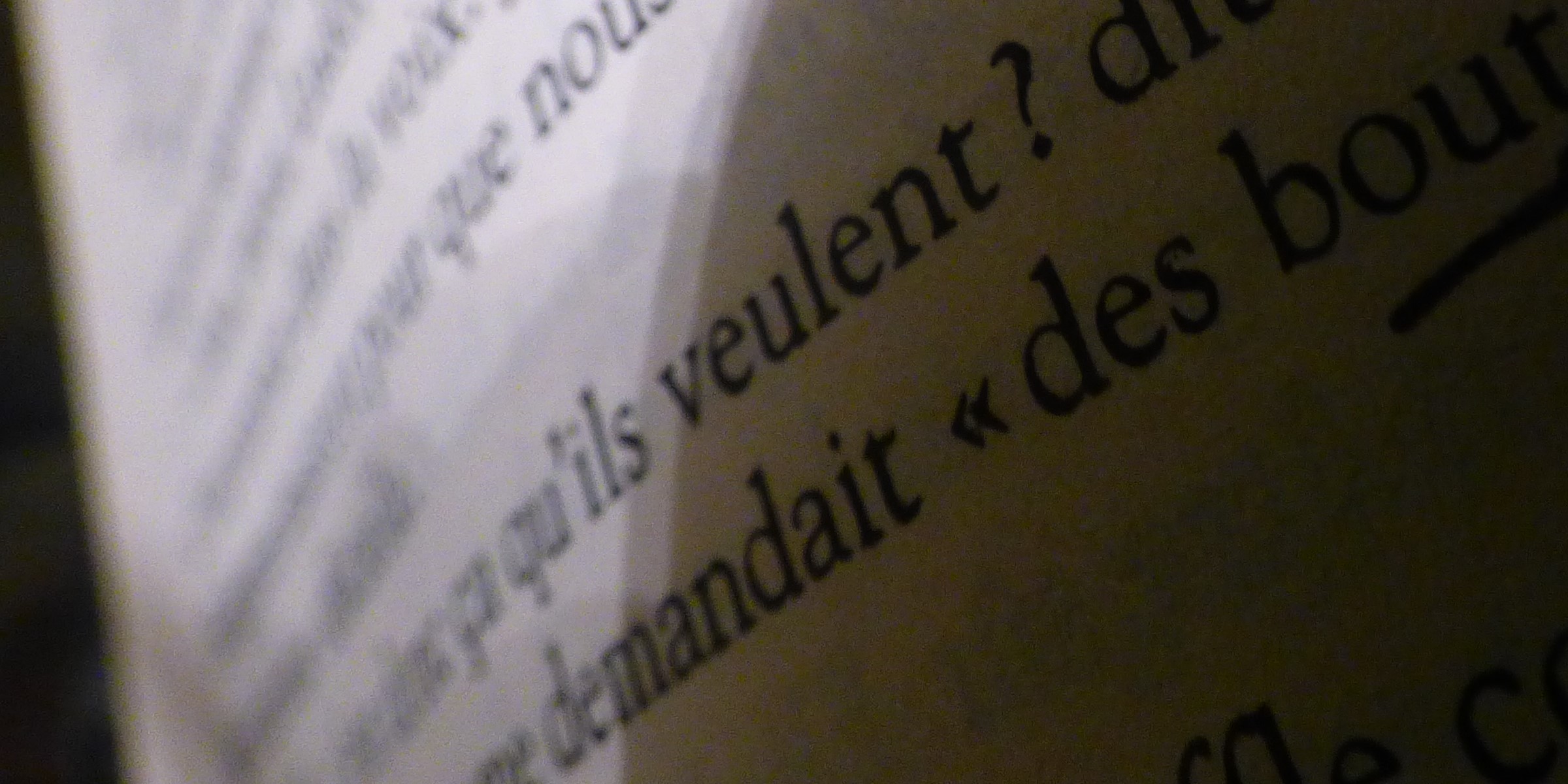Und plötzlich bin ich wieder in Deutschland. Nach einem halben Jahr im indischen Ozean brauchte es nur 1 ½ Tage Reise, um Palmen und Vulkane gegen die gewohnte Kultur- und Industrielandschaft wieder einzutauschen.
Ich mache erstmal eine Fahrradtour mit meinem Vater, freue mich über das entspannte Flachland und bestaune tatsächlich auch die so bekannten Orte, denen jetzt irgendetwas Neuartiges innezuwohnen scheint. Ich kann es kaum beschreiben. Ich habe neue Augen für sie.
Und ich brauche ein bisschen Zeit, um mich wieder umzuorientieren. Die Müllsortierung muss wieder umgelernt werden. Ich muss nicht mehr auf Tigermücken, aber auf Zecken aufpassen. Andere Vögel singen wieder andere Lieder. Bekannte, wieder faszinierende Lieder. Französisch wird auf Pause geschaltet. Auch ich singe wieder andere Lieder.
In welchem Film hab ich da mitgespielt? Wen hab ich da gespielt?
Die Erinnerung an eine Welt fern der Geschichten, fern der Analogien, scheint still wie der Weltraum. Still wie die tiefgrünen, dichtbewucherten Berghänge von la Réunion. Trotzdem kann doch der Sprung heraus nicht größer sein als ein Sprung innerhalb?! Aber wohin will ich springen?
Ich habe unglaubliche Arroganz gezeigt. Ich habe mich selbst mit meiner Vergangenheit aufgewertet. Sie war mein eigentlicher Spiegel, für die Anderen nur die hintergründige, wiederholende Brandung. Und mir selbst habe ich mit den dunklen Flecken meiner Geschichte bescheinigt, mehr verdient zu haben.
War ein Krieg mit mir selbst, mit meiner Psyche, wirklich notwendig?
Da kämpft nichts in mir mit etwas Anderem. Da ist nichts Anderes. Nur noch mehr Verwandtes, das noch nicht erkannt wurde.
Brachten die kolonialen Palmen als Symbol eines falschen Paradieses wirklich eine Erkenntnis, die nicht erst in sie hineingelegt werden musste?
Und was wäre das beste Symbol meines persönlichen Paradieses? Der Nicht-Ort, nach dem ich schwärme, hat schon immer ein sentimentales, mehrteiliges Narrativ.
„Krieg der Sterne“ musste herhalten. Und diese Lieblingsbilder meiner Kindheit habe ich gespalten und abgewandelt. In eine Zeit, die so niemals da war. So, wie wenn jemand dir oft genug von einem Bild erzählt, bis du irgendwann dich daran „erinnerst“, es selbst gesehen zu haben.
Du lächelst und runzelst die Stirn. Hinter dir die Sterne. Vor mir die Pflanzen, die alles umwuchern. Die Luft ist so feucht als würde sie selbst atmen. Halbwegs stark und vielmehr schüchtern stehen wir in der Welt unserer wiederholten Träume. Ich lernte von dir, Filme zu lieben – und ich will es nicht bereuen. Wir träumen noch immer. All die Heldenfiguren wurden zwar erkannt, in diesem anfangs noch so unschuldigen Märchen, aber wir haben sie nie wirklich aus uns verbannt. Schlussendlich auch kein Ende nach dem Abspann.
Da tanzt noch wer. Ich schaue zu. Da zittert noch ehrlich meine Gänsehaut. Meine kleine Katharsis – sie zieht mich gerade fast in den Abgrund.
Ich halte mich gerade noch so an der Kante fest. Diese Reise ist so schief gegangen. Aber ich habe mich dir endlich gegenübergestellt. Mein größter Held. Mein dunkelster Feind. Mit deiner Maske aus Stahl und Blei und Aluminium und deinem rhythmischen Keuchen. Du willst es nicht, aber du holst aus…
Bis ich mich fallen lasse. Und in diesem Kampf nur mit dem Verlust einer Hand gebüßt habe.
Der Milleniumsfalke holt mich etwas später ab.
…
Es ist manchmal fast so, als wäre es auch Teil meiner Geschichte. Ich habe sie oft genug gesehen – die drei Trilogien in den Sternen. Jede Reihe etwas anders.
Ich habe meine Kindheit gelebt und genossen, ohne sie zu verstehen. Ich habe meine Jugend geliebt und gehasst, ohne sie zu genießen. Und ich habe mein Erwachsenwerden fast nur benutzt, um zurückzusehen oder vorauszuplanen.
Mein heutiges Leben ist dankbar voller Geschichten und ernsthaften Sentimentalitäten. Und das Jetzt wird immer noch zu oft vergessen.
Ich habe das wahre Träumen verlernt.
Und versuche nun, Ersatz zu finden. Finde Neurosen, Spirituosen und Utopien, die sich mir nur flüchtig versprechen. Und werde dann doch wieder erinnert an eigentlich altbekanntes Wissen. Und das sowohl von griesgrämigen Nihilisten als auch fliegenden Optimisten. Und dankbar bin ich beiden. Bin ich selbst jedoch nichtmals ansatzweise eine Waage aus Zweien, sondern Gericht, Friedhof und Geburtenkammer von Ideen.
„Star Wars“ ist mittlerweile echt ein alter Hut. Auch andere Filme und Geschichten haben mich, den Sonst-zu-Erwachsenen, wieder dazu gebracht, täglich die Sterne anzusehen. Wobei es nicht einmal um Sterne gehen muss. Aber um etwas Größeres, das mich nach dem Abschalten des Bildschirms nicht aufhält, sondern motiviert, mich achtsam mit meiner geliebten Sentimentalität auseinanderzusetzen.