Nein, dieser Text handelt nicht vom Coronavirus. Oder doch? Schließlich verschafft der Virus der Welt eine gänzlich unerwartete Pause. Die dringend notwendige Zeit zum Nachdenken, wenn man zuhause sitzt und es sich endlich einmal wieder erlaubt, eine Grippe auszukurieren, mit Paracetamol, viel Schlafen und Hustentee. Anstatt sie, wie es längst üblich ist, zu übergehen und einfach den Alltag durchzuziehen, den immer gleichen Mustern folgend, den einmal etablierten Denkstrukturen, denen wir nie die Macht überlassen wollten, und die uns trotzdem beherrschen, weil wir sie manchmal über Jahrzehnte und historische Umbrüche hinweg nicht losgeworden sind.
Wohin versteinerte Wahrnehmungsroutinen führen können, hat der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger kürzlich in Kassel vorgeführt. Die „Reichen“ endlich für „vernünftige Arbeit“ einzusetzen, sei, so meinte er, besser, als sie zu erschießen, wie es eine Diskussionsteilnehmerin mit fragwürdiger Ironie vorgeschlagen hatte. Wer über biografische Erfahrungen mit der deutschen Linken verfügt, kennt das Muster und beruhigt sich mit dem Trost, dass es nicht gleich jene Fischmehlfabrik sein muss, in die eine linksautoritäre Sekte in den Frankfurter 70er Jahren die linkslibertäre Konkurrenz nach erfolgreicher Revolution schicken wollte, (damals wäre Fischmehl noch als ökologisch korrekt durchgegangen). Die Erregung im parteipolitischen Wasserglas, die auf das Riexinger-Spektakelchen folgte, verdeckt aber das eigentliche Problem: Dass geistige Schemata und Deutungsmuster, einmal eingerastet, einfach weiter in Betrieb sind, während die gesellschaftliche Wirklichkeit sich längst um Lichtjahre entfernt hat. Das Fortwirken des Anti-Kommunismus der Nachkriegszeit im jüngsten Thüringer Wahldrama ist nur ein anderes aktuelles Beispiel für diesen Gap.
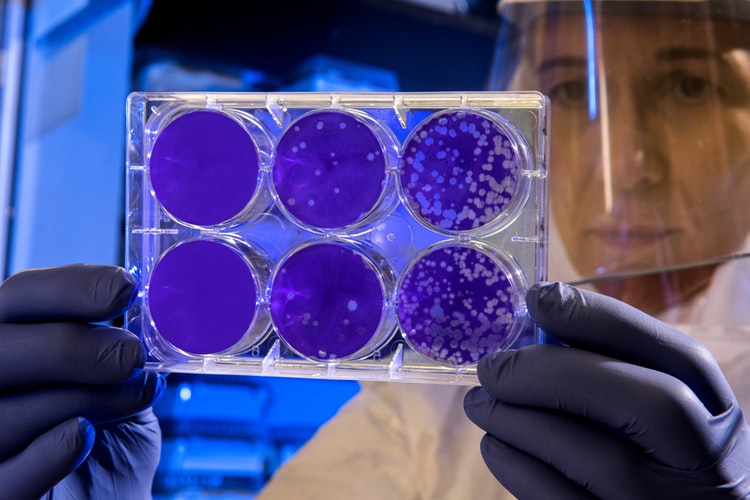
Überkommene Denkschemata systematischer Kritik zu unterziehen, bedeutet echte Arbeit, und man braucht dazu etwas, das Spitzenpolitiker am allerwenigsten haben, nämlich Zeit. Das gilt sogar für die Umweltpolitik, ein relativ junges Feld, in dem sich kontroverse neue Techniken gegenüberstehen und viele Ergebnisse sicht- und messbar sind. Solch scheinbar unbezweifelbarer Rationalität zum Trotz wurden bekanntlich vor 100 Jahren die ersten Benzinautos nach einem alten Muster, nämlich dem Vorbild von Pferdekutschen gestaltet, eine Kuriosität, über die wir heute lachen können, während vor unseren Augen die modernen Elektrofahrzeuge die fossil betriebenen Straßenpanzer der letzten 20 Jahre mit ihren überdimensionierten Kühlerhauben hochsensibel nachempfinden.
In der kurzen Geschichte der Umweltpolitik gibt es längst zahlreiche Muster, die, einmal etabliert, kaum mehr hinterfragt werden können, sei es der „Biosprit“ genannte Agrardiesel, sei es der euphemistisch zur „Kreislaufwirtschaft“ geschönte Verpackungswahn. Mit der Folge, dass die Alternativen weder ausgearbeitet noch durchgesetzt werden können. Das hat gewiss mit machtvollen Interessen zu tun, die sich hinter etablierten technischen Pfaden schnell versammeln, also auch hinter manchen Ökotechniken. Aber es ist auch eine Frage der gedanklichen Anstrengung, der Zeit zum Nachdenken. Von den VerteidigerInnen des Status Quo ist dabei noch gar nicht die Rede gewesen, all den Propagandisten des Verbrennungsmotors (gern auch mit Wasserstoff betrieben), der Kohle (kombiniert mit „CCS“) oder der „billigen Kernkraft“, deren technisches Retro-Utopia ohne jede ökonomische oder naturwissenschaftliche Plausibilität auskommt, weil es eigentlich nur darum geht, ressourcenverträgliche Innovationen zu bremsen.
Dass die Beschreibung von Gesellschaften und die Entwicklung von Ideen zu ihrer Zukunft hinter realen gesellschaftlichen Entwicklungen her hinkt, wird in Umbruchszeiten besonders sichtbar. Hegels berühmtes Diktum, „die Eule der Minerva“, die Erkenntnis, beginne erst „am Abend“, nach den Ereignissen des Tages, ihren Flug, hilft da politisch wenig, denn schließlich will Politik ja Einfluss nehmen auf das, was am Tag passiert.
Tragisch wird es, wenn ausgerechnet diejenigen, die für die Schwachen oder für die Demokratie in den Kampf ziehen möchten, dabei die Landkarten des letzten oder gar des vorletzten Jahrhunderts verwenden, weil sie sich an das speckige alte Papier gewöhnt haben. Einschließlich der sozialmoralischen Entwertung von Menschengruppen: Das „reiche“ Prozent, diese Faulenzer, sollen endlich mal was Richtiges arbeiten. Noch vor 20 Jahren wäre er mit solchem Unfug nicht aufgefallen, viele Linke, auch „Marxisten“ haben so gesprochen, Marx selbst übrigens nicht.
Tragisch sind solche linken Sackgassen, weil sie die gesellschaftliche Entwicklung blockieren können. Frankreich ist das sichtbarste Beispiel, wo der „Klassenkampf“ samt Opfermythos und personalisierten Feindbildern zum Selbstzweck eines Teils der Gesellschaft geworden ist und die demokratische Republik zerstört, anstatt ihr Entwicklungsoptionen zu öffnen und die dringend notwendigen neuen Bündnisse für mehr Gerechtigkeit und vernünftige Umweltpolitik zu ermöglichen. Le Pens Front National braucht nur abzuwarten.
Dabei ist nichts unwahrscheinlicher, als dass die alten „linken“ Schemata die Wirklichkeit noch gestalten könnten. Die dahergeredete „Revolution“ ist seit 100 Jahren ein Phantasma. Nicht das Handlungs- sondern das Blockadepotential der toten Träume und längst verschwundenen Utopien kann zum Hindernis werden. Denn auf diesen Deponien des Abgestorbenen wächst nichts. Und das Problem ist wahrlich nicht auf Riexingers Partei beschränkt oder auf den linken Teil des politischen Spektrums, im Gegenteil. Nur wirkt es dort besonders fatal, weil von dort die künftigen Innovationen kommen müssten.
Thomas Piketty, der Ökonom, der sich mit seinem Buch über „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ sprachlich in Marx Nachfolge einschrieb, ist von dieser Krankheit nicht befallen. Er führt die Ideen seines Lehrers Tony Atkinson, des linken britischen Ökonomen in Oxford, in die Gegenwart. Sein jüngster Vorschlag, jede/n einzelne/n Bürger/in zu befähigen, mit einem eigenen Startkapital von 60 % des jeweiligen nationalen Durchschnittsvermögens selbst ökonomisch wirksam zu handeln – anstatt nur die jeweilige Arbeitskraft anzubieten – ist ein Gegenmodell zu jener linken und linkssozialdemokratischen Welt, in der die ordentlichen Menschen ihr Gehalt bei immer größer werdenden Unternehmen verdienen, die am Ende nur noch vom Staat übernommen werden müssen, damit das Reich der Freiheit beginnen kann. Pikettys Schlüssel ist die Förderung von Eigentum, Handlungsfähigkeit und also sozialer wie politischer Selbstwirksamkeit: Entstehen würde eine Welt von KleinbürgerInnen, für die ein entsprechendes Umfeld an Handlungs- und Investitionschancen geschaffen werden müsste. Bäckereien in französischen Kleinstädten, ländliche Energie-Kooperativen in Polen, sie alle brauchen dringend das Startkapital Pikettys, um den Wettbewerb mit Konzernen aufnehmen zu können. Er weist kritisch auf die Belastung von kleinen und mittleren Unternehmen hin, die gerade in Deutschland die Steuersparmodelle der Multis kompensieren müssen. Die Versäumnisse der deutschen Wiedervereinigung, die den größten Teil der ostdeutsche Bevölkerung ohne nennenswertes Eigentum zurück ließ, werden so noch schmerzhafter sichtbar.
Das Ziel von Wirtschaft ist Freiheit, hat der Nobelpreisträger Amartya Sen gesagt und dabei die Handlungsfreiheit jedes und jeder Einzelnen gemeint, die auch soziale Sicherheit zur Voraussetzung hat. In Deutschland wurden solche Gedanken vor 70 Jahren durch Walter Eucken, Alexander Rüstow und die Freiburger Schule stark gemacht, sie haben diese Gedankenfigur gegen die Verbindung von ökonomischer und politischer Macht und die Dominanz der Großkonzerne gewendet. In der wirtschaftlichen Praxis wurden damals allenfalls einzelne Versatzstücke erkennbar. Heute liegen Gedanken wie diese , auch dank Piketty, wieder auf der Straße, und sehen jeden, der etwas Zeit zum Nachdenken hat, fragend an. Es braucht etwas Mut, sie aufzuheben und politisch zu beantworten. Vielleicht bietet sich ja schon bald eine Gelegenheit dazu, bei den Konjunkturprogrammen, die nach der Corona-Krise fällig werden.
Die erzwungene Ruhe im öffentlichen Raum könnte demnach Gutes bewirken. Wenn sich verfestige Denkmuster nur durch Nachdenken beiseiteschieben und durch neue Gedanken ersetzen lassen – jetzt wäre dafür Zeit.



