Nachdem die Wähleranteile der Sozialdemokratie und der Linken in den vergangenen Jahren einen stetigen Abwärtstrend aufwiesen, ist eine Debatte über die Zukunft und Programmatik der politischen Linken mehr als überfällig. Für jeden, der dies noch nicht wahrhaben wollte, markiert die Bundestagswahl dabei einen Tiefpunkt. Denn auch der knappe Sieg von Olaf Scholz kann nicht über das strukturelle Problem der politischen Linken hinwegtäuschen. Von einem Siegesrausch sind die aktuellen 25,7 % der Sozialdemokratie weit entfernt.
Die Rolle, die Sahra Wagenknecht im Wahldebakel ihrer Partei spielte, sollte nicht überbewertet werden – das würde allzu schnell von den manifesten Problemen linker Identitätsfindung ablenken. Ich betrachte die Situation eher als eine vertane Chance. Tatsächlich hätte Sahra Wagenknecht in dieser Krise eine konstruktive Rolle übernehmen können. Leider verspielte sie diese Chance mit ihrem jüngsten Buch Die Selbstgerechten, das fünf Monate vor der Bundestagswahl veröffentlicht wurde.
Ambitioniert spricht sie alle aktuellen Politikfelder der Bundesrepublik und insbesondere der Sozial- und Wirtschaftspolitik an: die Migration, die Minderheitenpolitik, Europa, den Islamismus, die Klimakrise und Umweltpolitik, nationale und kulturelle Identitäten, den Lobbyismus, Fragen der direkten Demokratie, die Medienkonzentration, den Finanzkapitalismus, die digitale Wirtschaft und deren Monopole und die Veränderung der Mittelschicht.
Diese thematische Auseinandersetzung bettet Wagenknecht in einen Angriff auf die „Lifestyle-Linken“ ein, die linksliberale Ideen vertreten würden, allerdings räumt sie ein: „Genau besehen ist die so bezeichnete Strömung nämlich weder links noch liberal…“ (S. 12). Gleichzeitig zeichnet Wagenknecht geradezu karikaturenhaft ein Bild dieser Lifestylelinken, die heute meist gut betuchte Akademiker seien, bio einkaufen, sich um Gendersternchen sorgen und wohlmöglich noch einer urbanen LGTBQ oder zugewanderten Minderheit angehören. Sie verachten den Ballermanntourismus, unternehmen selbst aber „Bildungsreisen“ oder begeben sich auf Selbstfindung ins Ayurveda-Hotel. Aufgrund ihrer privilegierten Stellung sind sie laut Wagenknecht unfähig, echte linke Politik für die Unterprivilegierten zu betreiben.
Diese Einsichten verknüpft Wagenknecht mit einer Grunderzählung, die man sonst nur aus Rentnerrunden kennt: Früher war alles besser. Sie bemängelt beispielsweise dass die Aufstiegschancen in der Mittelschicht im Vergleich zu den Wirtschaftswunderjahren bis in die 1980er heute gekappt seien und sich ein akademischer Erbadel herausgebildet habe. Als Beleg für diese These führt sie dann Statistiken zu den veränderten Verdienstmöglichkeiten von Journalisten in Großbritannien an (S. 91).
Der Autorin scheint jedoch entgangen zu sein, dass sich die soziale Schichtung der deutschen Gesellschaft seit 1949 auch grundlegend gewandelt hat. Wenn es eine Erfolgsgeschichte gibt, dann ist es gerade der Bildungssektor. In der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft betrug der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Hochschulreife gerade mal 5 bis 7 %, für Gymnasien (und auch Oberschulen in der DDR) wurde bis 1957/58 Schulgeld verlangt. Heute beträgt die Quote mehr als ca. 50% (ca. ein Viertel fällt auf das Fachabitur) und die Hälfte der Studierenden sind Frauen.
Ein Politikverständnis, das wie bei Wagenknecht (oder Jeremy Corbyn) auf Ideen von sozialen Klassenstrukturen und -interessen beruht, wie sie um 1900 geherrscht haben, läuft damit ins Leere. Es macht schlicht keinen Sinn, nahezu jeder und jedem die Legitimität für linkes politisches Engagement abzusprechen, wenn man zum Beispiel einen Aufstieg durch Bildung geschafft hat. Natürlich ändert sich, wie sich linke, sozial und ökologisch engagierte Politik definiert.
Ein gutes Beispiel, wie ihr der einigende Ruf misslingt, ist Wagenknechts Kampf gegen die Gendertheorie und die Anstrengungen für eine gendergerechte Sprache. An Stelle einer substantiellen Auseinandersetzung wiederholt sie hier polemische Narrative, die im rechtskonservativen und christlich-fundamentalistischen Milieu im Kriegszug gegen den so genannten „Genderismus“ präsent sind. Die Existenz eines biologischen Geschlechtes würde laut Wagenknecht (S. 31) in dieser Theorie grundweg geleugnet (was natürlich nicht stimmt: Der englische Begriff „gender“ dient theoretisch ja gerade dazu, um die soziale Konstruiertheit z.B. von „Frau“ oder „Mann“ im Gegensatz zur biologischen Körperlichkeit zu markieren, dem englischen „sex“).
Man könne als Mann auch kein nett gemeintes Kompliment an eine Frau loswerden, ohne einen Sexismus-Vorwurf zu riskieren (S. 31). Mehr Stammtisch ist kaum noch möglich … oder gibt es für diese Behauptung irgendwelche Belege? Und mal ehrlich, Frau Wagenknecht, würde ein Verehrer Ihnen nur unentwegt Komplimente für Ihr Aussehen machen, wären Sie sicher nach wenigen Minuten ähnlich wie die geistreiche Roxane aus Cyrano de Bergerac von ihrem einfallslosen Bewunderer zu Tode gelangweilt.
Und bitte, wenn man oder frau sich mit Gender-Theorie auseinandersetzt, sollte immer das Bemühen bestehen, exakt zu zitieren, kontextualisieren und nicht plakativ zu polemisieren. So wird (mit Bezug auf schlechte Sekundärliteratur) von Sahra Wagenknecht behauptet, Judith Butler würde die Burka als Symbol weiblicher, familienverbundener Werte „bejubeln“ (S. 120). In dem entsprechenden Interview von 2003, das im Kontext des Irak- und Afghanistan-Krieges unter Präsident George W. Bush stand, gab Butler lediglich zu bedenken, dass das Ablegen der Burka nicht einfach gleichgesetzt werden kann mit einem Akt der Befreiung (aus westlicher Sicht). Sie bezieht sich explizit auf die Forschungen der Anthropologin Lila Abu-Lughod in Ägypten, die aufzeigen, was die Burka für viele Frauen in ihrer Kultur bedeutet. Hier nun eine Verbindung zwischen Islamismus, Feminismus und Gendertheorie zu konstruieren, ist abenteuerlich.
Aus feministischer Sicht ist die Kopftuchfrage auch kaum mit einem eindeutigen „Ja“ oder „Nein“ zu lösen, stehen sich doch Positionen kultureller weiblicher Selbstbestimmung und ein westlich-feministischer Freiheitsbegriff gegenüber. Den „Linksliberalen“ wirft Wagenknecht vor, sich heutzutage aus Hang zum Multikulturalismus für die Verschleierung der Frau einzusetzen. Aus ökonomischer und emanzipatorischer Perspektive jedoch müsste Sahra Wagenknecht selbst eigentlich zu dem Schluss kommen, dass eine gesellschaftliche Toleranz gegenüber dem Kopftuch muslimischen Frauen in Deutschland eine solide, gar verbeamtete Berufsperspektive bieten würde, die viele von ihnen aus Gründen ihrer persönlichen Überzeugungen andernfalls niemals wahrnehmen könnten. Diese ökonomische Emanzipation hätte dann zweifellos weitere Folgen für das Rollenverhältnis von Männern und Frauen. Das Kopftuch andererseits für eine identitätspolitische Debatte zu instrumentalisieren, wäre genau das, was Wagenknecht den Lifestyle-Linken unentwegt vorwirft: Symbolpolitik.
Wenn die Linken-Politikerin in dieser Gender-Debatte letztlich darauf hinaus will, dass wir nicht die realen sozialen Problemlagen von Frauen aus dem Blick verlieren dürfen, dann würde dieses vollkommen berechtigte Argument sicherlich breite Unterstützung (der gescholtenen Lifestyle-Linken) finden. Nur geht es bedauerlicherweise in dem Rundumschlag gegen die Gendertheorie unter.
Das ist eine Auseinandersetzung bestenfalls auf Talkshow-Niveau.
Vielleicht sollte man in der Politik einen Vorschlag aus der Paartherapie beherzigen. Glückliche Liebesbeziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass Lob und Kritik im Verhältnis 5:1 stehen. Wer einmal kritisiert, der sollte dann fünfmal seine Wertschätzung ausdrücken. Im Politischen würde dies bedeuten, gemeinsame Ziele – common ground – zu suchen und auch gegenseitige Anerkennung für das gemeinsame Streiten auszudrücken. Wer soll denn mit Sahra Wagenknecht für ihre Vision einer politischen Erneuerung der Linken kämpfen, wenn sie allen alliierten politischen Kräften die Legitimität abspricht?
Schon der Buchtitel „Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ erweist sich als Oxymoron: Es ist ein politischer Angriff auf weite Teile ihrer genuinen politischen Verbündeten und kein Einigungsversuch. Denn Lifestyle-Linker ist nach Wagenknecht schließlich fast jeder und jede, die ihr Konsumverhalten reflektiert, sich „fröhlich, bunt und gut gelaunt“ auf die Unteilbar-Demos gegen Rassismus begeben hat und wahrscheinlich auch all diejenigen, die über genügend Zeit und einem intellektuellen Interesse verfügen, Bücher von Sahra Wagenknecht zu lesen. Das Buch ist eigentlich nur noch eine Abrechnung von der saarländischen Seitenlinie aus, es ist kein Gegenprogramm sondern ein Gegenschlag – denn auf der programmatischen Ebene fällt es dünn aus und verliert sich häufig auf schwammigen Allgemeinplätzen.
Dabei wäre es ein Leichtes, mit spezifischen programmatischen Ideen alte und neue Mitstreiterinnen zu finden. Wie wäre es mit der Forderung, ein Prozent mehr des Bruttoinlandsproduktes für Bildung auszugeben, anstatt eine unsinnige Steigerung im Verteidigungshaushalt zu erreichen. Im Bereicht der Bildung befindet sich Deutschland nämlich mit 4,2 % nur auf Platz 27 unter den 36 OECD-Staaten (laut den aktuellsten, verfügbaren Daten von 2017).
Das wäre doch mal ein konkreter Vorschlag, der fraglos viel Unterstützung im linken und mittleren politischen Spektrum finden würde. Ach so, das sind ja alles nur Lifestyle-Linke, mit denen man keine echte Politik mehr machen kann …
Bildnachweis:
Sahra Wagenknecht, Bundesparteitag Die Linke 2018 in Leipzig, Sandro Halank, Wikimedia Commons
https://de.wikipedia.org/wiki/Sahra_Wagenknecht#/media/Datei:2018-06-09_Bundesparteitag_Die_Linke_2018_in_Leipzig_by_Sandro_Halank%E2%80%93126.jpg



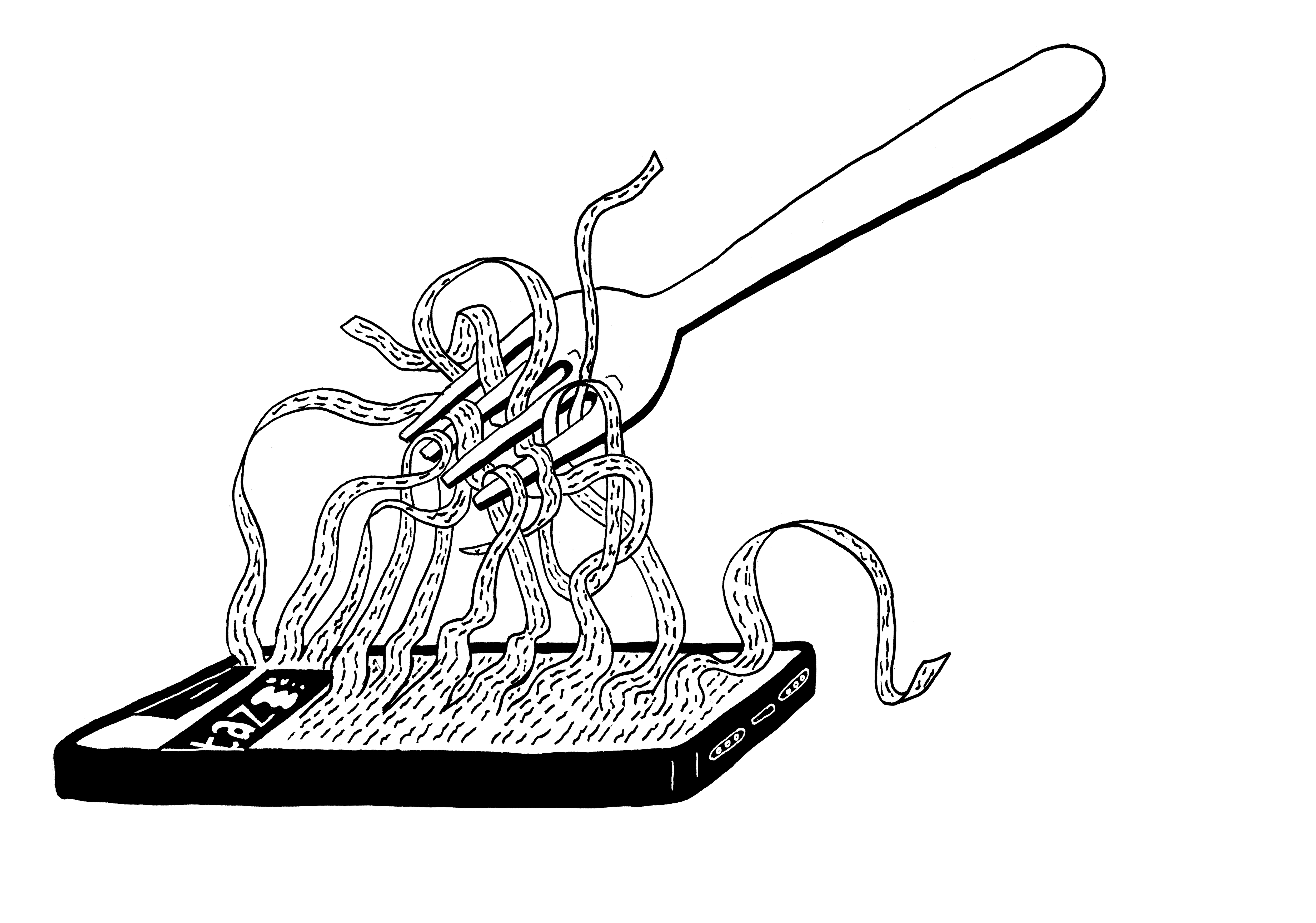
Mittlerweile bin ich zur Überzeugung gelangt, dass Frau W. völlig falsch eingeordnet und überschetzt wird. Schaut man sich Ihre Veröffentlichungen auf Youtube an, wird es im kontext der hier geäußerten Kritik richtig gruselig. Frau W. liefert der unsäglichen Hufeisentheorie eine Daseinsberechtigung weil sie meint, man könne das National in Nationalsozialismus klein schreiben und wäre dann links. Und damit nicht genug, lassen ihre weiteren Ausführungen zur Pandemie den geneigten Betrachter fassungslos zurück. Ihre verschwörerischen Ansätze vermitteln den Eindruck, dass sie entweder noch einfacher gestrickt ist, als zu vermuten wäre oder sie das Geschäftsmodel der Verschwörungsunternehmer für sich entdeckt hat. Letzteres wäre ja eine Entwicklung die in jüngster Zeit häufig zu betrachten ist, wenn sich Ikonen einer bestimmten Blase vernachlässigt oder in ihrer vermeintlichen Kernkompetenz nicht mehr ausreichend bestätigt fühlen und sich einem leicht zu überzeugenden und sehr spendablem Puplikum zuwenden, dass auch immer wieder mediale Schützenhilfe bei der Ermächtigung seiner Propheten erhält.