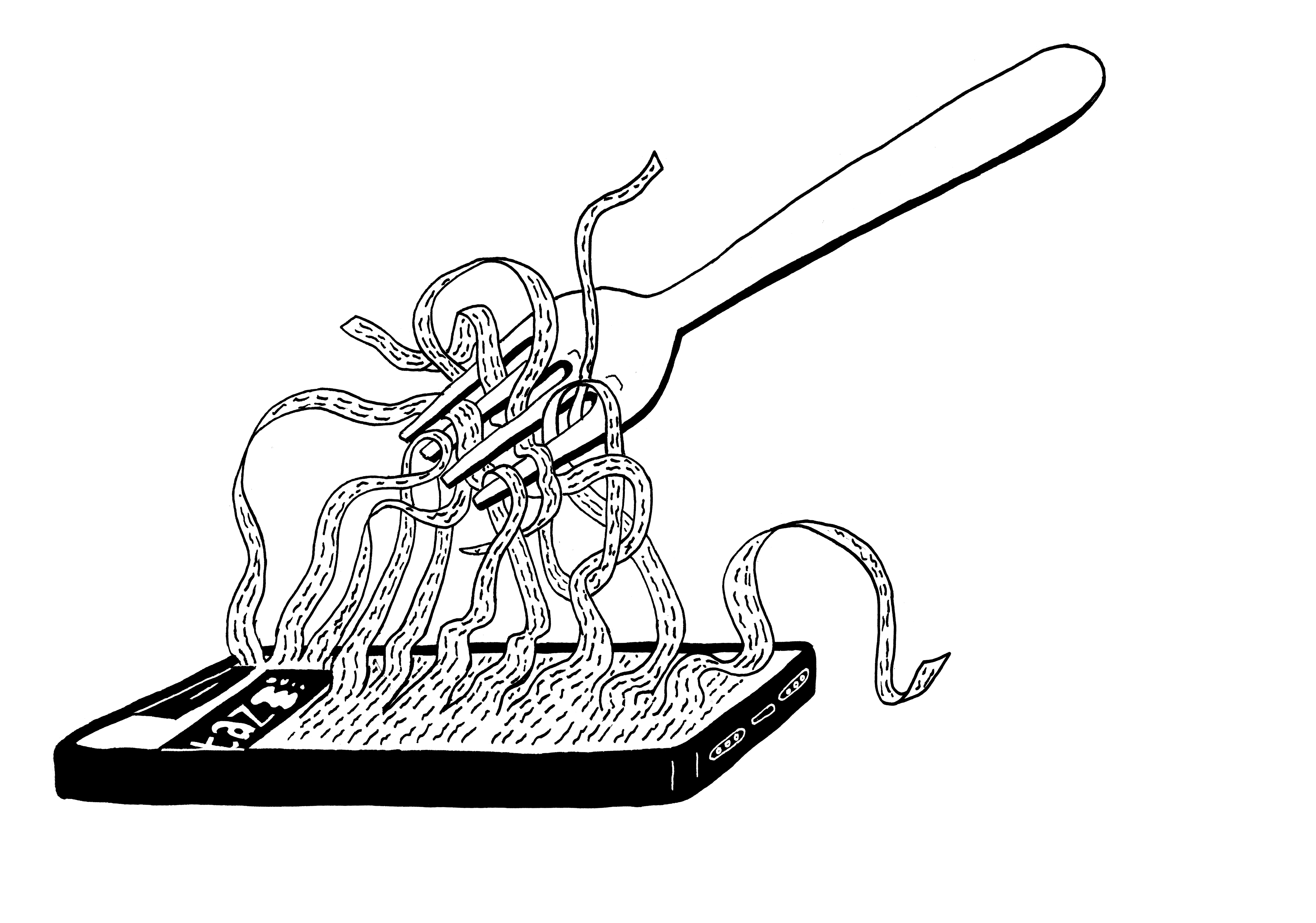Ich habe einen sehr schönen Text über den Umgang mit Schmerzen gelesen. Er heißt „Die verwundete Frau“ (2015) von Leslie Jamison.
Sie breitet darin viele Formen von weiblichem Schmerz und Verwundungen aus: Liebeskummer, Narben durch Unfälle und Krankheiten, selbstzugefügte durch Ritzen und Abmagerung, Geburtsschmerzen, Menstruationsschmerzen, Prügeleien, Gewalterfahrungen, emotionale Misshandlungen…
Die Scheinheiligkeit, wie Schmerz solcher Art empfunden, mitgeteilt, geheilt werden darf, kennt jede von uns und verdrängt damit, welche Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des Lebens eigentlich im Leid stecken.
Die Banalität des Schmerzes
Leslie stellt in ihrem Text fest, dass die Empfindung, das Fühlen von Schmerz häufig mit Witzen oder intellektuellem Gerede abgetan wird. Anstatt solche Gefühle überhaupt erst zu empfinden, geschweige denn auszudrücken, versucht frau: sarkastisch, apathisch, undurchschaubar, cool oder clever zu sein, weil das Ausdrücken von Schmerz nur um des Schmerzenswillen oder der Aufmerksamkeitwillen belächelt wird und als Beschränkung gilt, abgetan wird als: sich-im-Schmerz-suhlen.
Da es dabei scheinbar um die immer gleichen „banalen“ Geschichten von: gebrochenen Herzen, Ablehnung, Benutzung, Verlust von Schönheit, Missachtung und andere solche Dinge geht, bei denen das Empfinden von Schmerz, der Wunsch nach Mitleid oder Aufmerksamkeit für das schmerzhafte Gefühl als banal und nicht angebracht von der Gesellschaft abgewertet wird.
Mäßige dich … nicht!
Leslie Jamison aber kommt in ihrem Text zu dem Schluss, dass solcherlei Schmerzen eigentlich nie als banal bezeichnet werden dürften, sondern dass sie gefühlt, empfunden und mitgeteilt werden sollten, dass es sogar notwendig ist, Schmerz (und Verletzungen) darzustellen, weil er nunmal da ist, empfunden wird und dass die Frau sich darin, den Schmerz auszudrücken, eben nicht zügeln, ihn nicht von vornherein unterdrücken sollte, weil nur dann etwas Dahinterliegendes, etwas Neues, etwas zu erfassendes daraus entstehen kann.
Wir sollten uns nicht vorher schon darin zügeln und das Bedürfnis eben nicht unterdrücken, weil wir uns vor uns selbst schämen oder unserer Umwelt gegenüber, dass wir einen tiefen Schmerz empfinden, wo andere vielleicht nur die Schultern zucken und ihn als banal abtun würden. Wenn wir aber genau davor Angst haben, vor Selbstmitleid zu zerfließen, diese Identität von anderen aufgestempelt zu bekommen, dann suchen wir Zuflucht in Selbsterkenntnis, Selbstironie und Sarkasmus.
Denn genau dieser äußere Vorwurf, der aber schon viel zu lange im weiblichen Klischee und in der Geschichte der weiblichen Sozialisation verinnerlicht ist, bietet unseren verschlossenen Herzen zu viele Alibis, als dass sich unsere Herzen öffnen könnten.
Dabei ist es gerade bei Schmerzen und Wunden (selbst zugefügten oder von außen erlittenen) wichtig, dass unsere Herzen offen sind.
Jammer nicht so laut, sonst störst du noch den Nachbarn in seiner Ruh
Auch wenn Leslie Jamison ihren Text und Titel vornehmlich auf das Leid und den Schmerz von Frauen (vermutlich weißen Frauen) bezieht, würde ich die darin beschriebene Problematik der empfundenen Banalität besonders auf solche Verletzungen beziehen, die mit struktureller Diskriminierung einhergehen und insofern alle Menschen betrifft, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Identität, ihrer körperlichen Unversehrtheit und anderen Kategorisierungen marginalisiert werden. Es soll nicht offensichtlich werden, was Menschen alltäglich angetan wird und wenn keine schreit, stört sie die Nachbarn auch nicht.
Deshalb weite ich die von Leslie aufgestellte Forderung aus auf alle Menschen, die verletzt werden, die Leid und Schmerz empfinden und dies nicht äußern dürfen, sich stattdessen in Selbsterkenntnis und Selbstironie geißeln, um nicht auch noch aufgrund ihres Leidempfindens gesellschaftlich abgewertet zu werden.
Wir mögen uns häufig erst wieder in der Gesellschaft bewegen, wenn wir unseren Schmerz im stillen Kämmerlein überwunden und uns über unsere Narben einen dicken Panzer oder zumindest einen langen Ärmel gezogen haben.
Dabei wären es ja genau solche, durch eine Gesellschaft verursachten Verletzungen, die im wahrnehmenden und anerkennenden Miteinander geteilt und dadurch auch ein bisschen geheilt werden könnten.
Aber es ist natürlich unangenehm für die Mitmenschen, wenn man mit dem Schmerz einer Verletzung, mit dem Leid aus einer emotionalen Verletzung konfrontiert wird, wenn man sich nicht der Illusion hingeben und seine wohlverdienten Ruhephasen genießen kann.
Aus diesem Grund wird Schmerz und Leid immer als angemessen und nicht angemessen bewertet. Jede hat ein ziemlich genaues Gespür dafür, was in ihrer direkten Umgebung angebracht ist und verhält sich danach, anstatt sich mit ihrem Schmerz auseinanderzusetzen.
Die Bewertung ablösen durch Tiefe
Einer der wichtigsten Begleitumstände des Schmerzes oder des sich-in-Wunden-ergehen ist, dass frau ehrlich sich selbst gegenüber ist, sich einzugestehen, dass sie einen Schmerz, ein Leid über etwas empfinden kann und ein Bedürfnis danach hat, dies auch auszudrücken.
Denn es wäre eigentlich lebenswichtig, sich nicht auch noch der eigenen Verletzungen, des eigenen Leidempfindens, des Schmerzes wegen zu schämen, wie es vielleicht gesellschaftlich angebracht scheint, sondern, im Gegenteil, die eigenen Wunden als Orte der Lebensfähigkeit zu betrachten, an denen Schmerz auf Erfahrung trifft und etwas erhellt, wie Leslie Jamison so schön beschreibt.
Denn genau um diese Sichtbarkeit geht es dabei, diese Einstellung, Einzelteile im Verhältnis zueinander zu betrachten, die der Schmerz häufig erst möglich macht.
Und folgt frau dem hinein in das Eingeständnis, dass frau eine Wunde gleichzeitig begehren, aber auch verachten kann; dass sie Kraft verleiht, aber auch ihren Preis hat; dass das Leiden Tugend hervorbringt, aber auch Egoismus; dass sich die Opferrolle aus dem zusammensetzt, was einem passiert, und dem, was frau daraus macht; dass Schmerz Thema und gleichzeitig Produkt von Repräsentation ist, erst dann kommt frau zur Ehrlichkeit gegenüber sich selbst.
Denn zu leiden ist interessant, sich davon zu erholen auch.