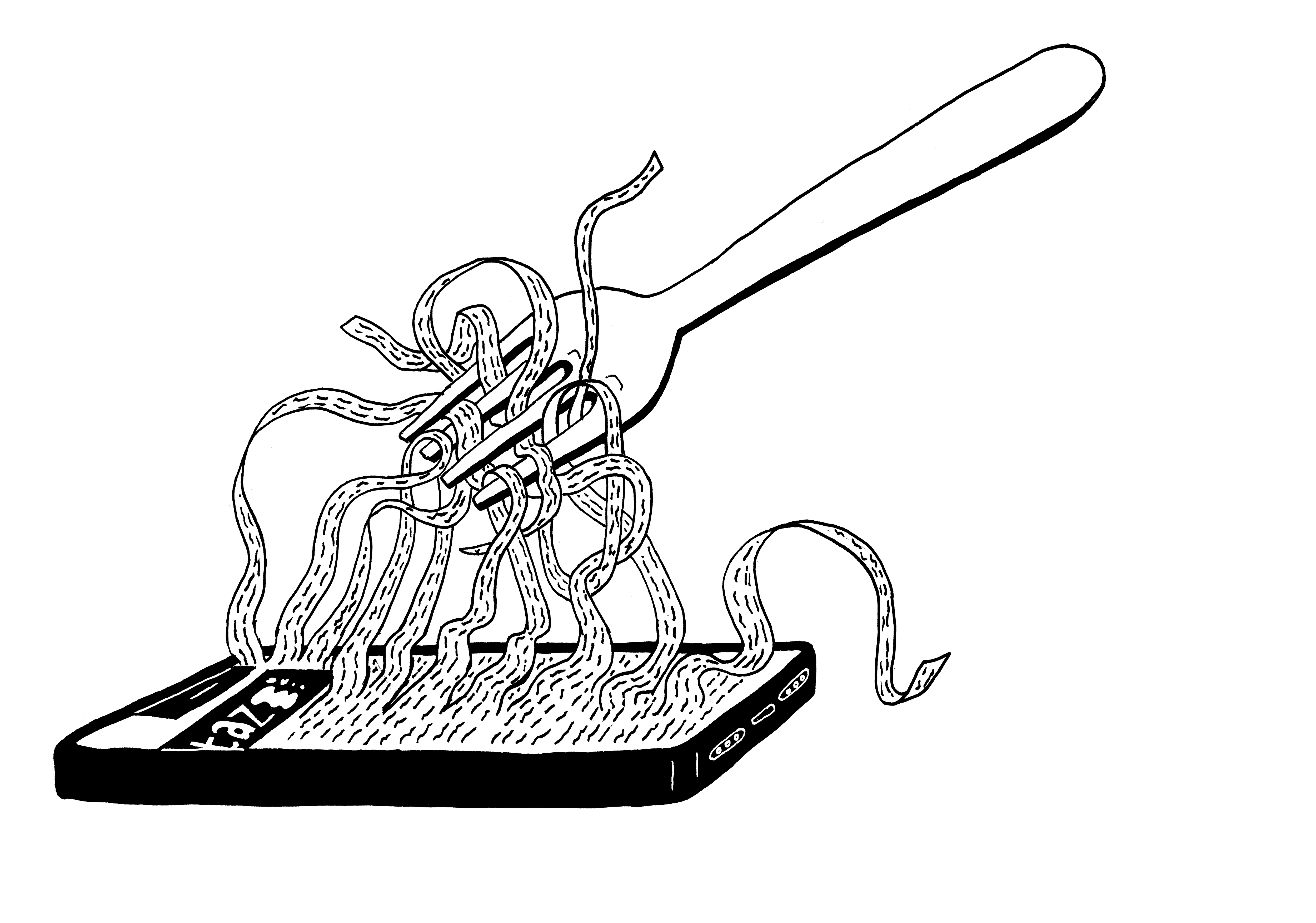Mit der Unabhängigkeit der Justiz ist es in Bolivien bekanntlich nicht weit her. Auch wenn die Mächtigen gerne das Gegenteil behaupten. Etwa wenn wieder mal ein Strafprozess gegen Oppositionelle eröffnet wird; oder wenn das Verfassungsgericht Paragraphen der Verfassung für verfassungswidrig erklärt, die den Interessen des Präsidenten im Wege stehen. Bisweilen widerrufen die Richter sogar frühere eigene „unumstößliche“ Entscheidungen, selbstverständlich genauso „unumstößlich und unanfechtbar“. Gleichwohl oder deswegen deutet sich derzeit mit dem politischen auch ein Wandel in der Justiz an.
Vermutlich waren es vor allem der massive Unmut in der Bevölkerung und drohende Massenproteste, die die Verfassungsrichter darin gehindert haben, die jüngsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ähnlich zu boykottieren wie die Richter*innen-Wahlen im vergangenen Jahr. Mit denen hätten sie selbst ersetzt werden sollen. Stattdessen verlängerten sie sich eigenmächtig ihr Mandat. Die Regierung blockierte ihre Absetzung. Vizepräsident David Choquehuanca legte das Parlament lahm, wo er konnte und Präsident Arce unterschrieb das dann doch verabschiedete entsprechende Gesetz einfach nicht, wie wir auf latinorama damals berichteten.
Wechsel in der Justiz
Dennoch kam es zu einer Teilerneuerung des Verfassungsgerichts sowie einer kompletten Erneuerung des Obersten Gerichtshofs und des Agrargerichtshofs. Möglich gemacht hat das auch der Verlust der Zweidrittel-Mehrheit der Regierungspartei MAS im Parlament. So standen diesmal auch Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, die nicht zur „Bewegung zum Sozialismus“ gehörten. So wie der neue Präsident des Obersten Gerichtshofs Romer Saucedo, der – obwohl vorher unbekannt und aus der Provinz – mit dem höchsten Stimmenanteil gewählt wurde. Saucedo hat zwar als Rechtsanwalt unter der MAS Regierung im Verteidigungsministerium gearbeitet. Doch er kannte den Minister Reymi Ferreira nicht von Parteitreffen, sondern aus dessen Zeit als Präsident der staatlichen Universität Gabriel René Moreno. Damals hatte sich Saucedo als junger Stadtrat von San Ignacio für die Eröffnung eines Jurastudiengangs in der Provinz Velasco eingesetzt. Es sei nicht die beste Idee Saucedos gewesen, meint zumindest sein Förderer Domingo Ábrego: Heute gebe es so viele Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen in San Ignacio, so der Volkspädagoge, dass es ihnen an Arbeit fehle und sie deshalb überall Streit suchen oder stiften würden.

„Nie wieder,“ versprach der inzwischen zum Präsident des Obersten Gerichtes gekürte Romer Saucedo jüngst vermutlich zu optimistisch, werde „die Justiz als Instrument der politischen Verfolgung dienen, weder von Links noch von Rechts“. Nur kurz zuvor war noch ein Versuch der Regierung knapp gescheitert, durch die Absetzung einer Kollegin von Saucedo die Mehrheit der MAS im Obersten Gerichtshof zurück zu gewinnen. Der damalige Justizminister und diverse Justizangestellte müssen sich jetzt vor Gericht gegen den Vorwurf der Bildung eines Konsortiums zur Rechtsbeugung verteidigen.
Und so ist der frühere Kinder- und Jugendrechtsaktivist Saucedo vielleicht ein Beispiel, dass nicht nur der bevorstehende Antritt einer neuen Regierung, mit der man es sich nicht verscherzen will, Richterinnen und Richter zu Entscheidungen motiviert, die in den langen Jahren der weitgehenden Kontrolle der MAS über die Justiz undenkbar schienen. (Siehe auch diesen früheren Beitrag auf Latinorama).
Das größte Aufsehen erregte die Anordnung des Obersten Gerichtshofs an die zuständigen Gerichte, die rechtliche Gültigkeit der Untersuchungshaft der Übergangspräsidentin Jeanine Añez, des Gouverneurs von Santa Cruz Fernando Camacho und des früheren Sprechers des Bürgerschaftskomitees der Bergwerksstadt Potosí Marco Pumari zu überprüfen. Añez ist wegen eines bestehenden Schuldspruches noch im Frauengefängnis in Miraflores in La Paz in Haft. Das Verfassungsgericht prüft allerdings gerade dessen Rechtmäßigkeit. Mehrere Gerichte, die bislang weitere Verfahren gegen Jeanine Añez vorangetrieben haben, erklären sich – mit den veränderten Machtverhältnissen – inzwischen als unzuständig. Als Ex-Präsidentin müsse sie in einem Sonderverfahren des Parlaments verurteilt werden (siehe auch diesen früheren Beitrag auf latinorama).

Hausarrest statt Gefängnis
Anders als Añez konnte Marco Pumari nach dem Haftprüfungstermin inzwischen nach Hause zurückkehren. Ebenso Fernando Camacho, der nach den rechtswidrigen gut zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft im Hochsicherheitsgefängnis Chonchocoro im Altiplano wieder in seine Heimatstadt zurückkehren durfte. Dort wurde er von zigtausenden Anhängerinnen und Anhängern wie ein Hoffnungsträger empfangen, um noch am selben Tag auch wieder seine Amtsgeschäfte aufzunehmen. Nur sein Stellvertreter, Mario Aguilera, der nun wieder in die zweite Reihe treten muss, erinnerte Camacho daran, wie viele unnötige Gerichtsverfahren ihm schlechte Ratgeber eingebrockt hätten. Die Arbeit erlaubt Camacho nun, den nur unter Auflagen angeordneten Hausarrest zu verlassen. Der gilt noch so lange, bis diverse gegen ihn laufende Strafverfahren abgeschlossen sind. Und deren Ausgang ist noch keineswegs gewiss.
Nicht nur die neue Justizministerin Jessica Saravia protestierte nach den Haftenlassungen gegen die “empörende“ Entscheidung der Justiz. Dabei vermengte sie dann die beiden Prozesse wegen des angeblichen Putsches gegen Evo Morales mit den nachfolgenden gewaltsamen Konflikten: Die Regierung werde alles tun, damit die Massaker von Senkata und Sacaba nicht straflos blieben, so Saravia. An denen waren zwar Übergangspräsidentin Jeanine Añez, ihre Minister und Generäle beteiligt, bekanntermaßen aber nicht der politisch bald ausgebootete Luis Fernando Camacho und schon gar nicht Marco Pumari. Doch wenn es der aktuellen Regierung, wie Justizministerin Saravia betont, wirklich darum geht, dass den damaligen Todesopfern Gerechtigkeit widerfährt, dann hätte sie sich darum kümmern sollen, dass die Verfahren rechtsstaatlichen Kriterien entsprechen und dass tatsächlich die Verantwortlichkeiten aufgearbeitet werden. Die lagen damals auch bei denjenigen, die Privathäuser, Busse und Geschäfte in Brand setzten und mit bewaffneter Gewalt auf der Straße und dem Schlachtruf „Jetzt aber wirklich Bürgerkrieg!“ versuchten, den damals geflohenen Evo Morales aus Mexiko zurück in den Regierungspalast zu bringen (dazu auf Spanisch diese Recherche der Journalistin Amalia Pando).
Ein Ex-Häftling als Oberster Richter
Der Kritik, seine Anordnung auf Überprüfung der Haftfristen bei Añez, Camacho und Pumari sei politisch motiviert und nicht juristisch begründet gewesen, und Protestaktionen in den Gefängnissen antwortete Romer Saucedo mit der Anordnung, auch die Haftzeiten anderer Untersuchungshäftlinge zu überprüfen. Es ist die große Mehrheit derer, die in bolivianischen Gefängnissen einsitzen. Manche bereits länger als die mögliche Höchststrafe für die Taten, die ihnen vorgeworfen werden. Alle diese Fälle zu überprüfen, wird allerdings länger dauern, als in den politisch brisanten Fällen. Möglicherweise hat aber auch die persönliche Erfahrung Romer Saucedos eine Rolle gespielt. Über dessen dramatische Jugend werden wir in einem folgenden Beitrag der Reihe „Bolivianische Persönlichkeiten“ auf Latinorama berichten. Von klein an hatte Saucedo sich als Kinderreporter und in Kinderrechtsgruppen engagiert.
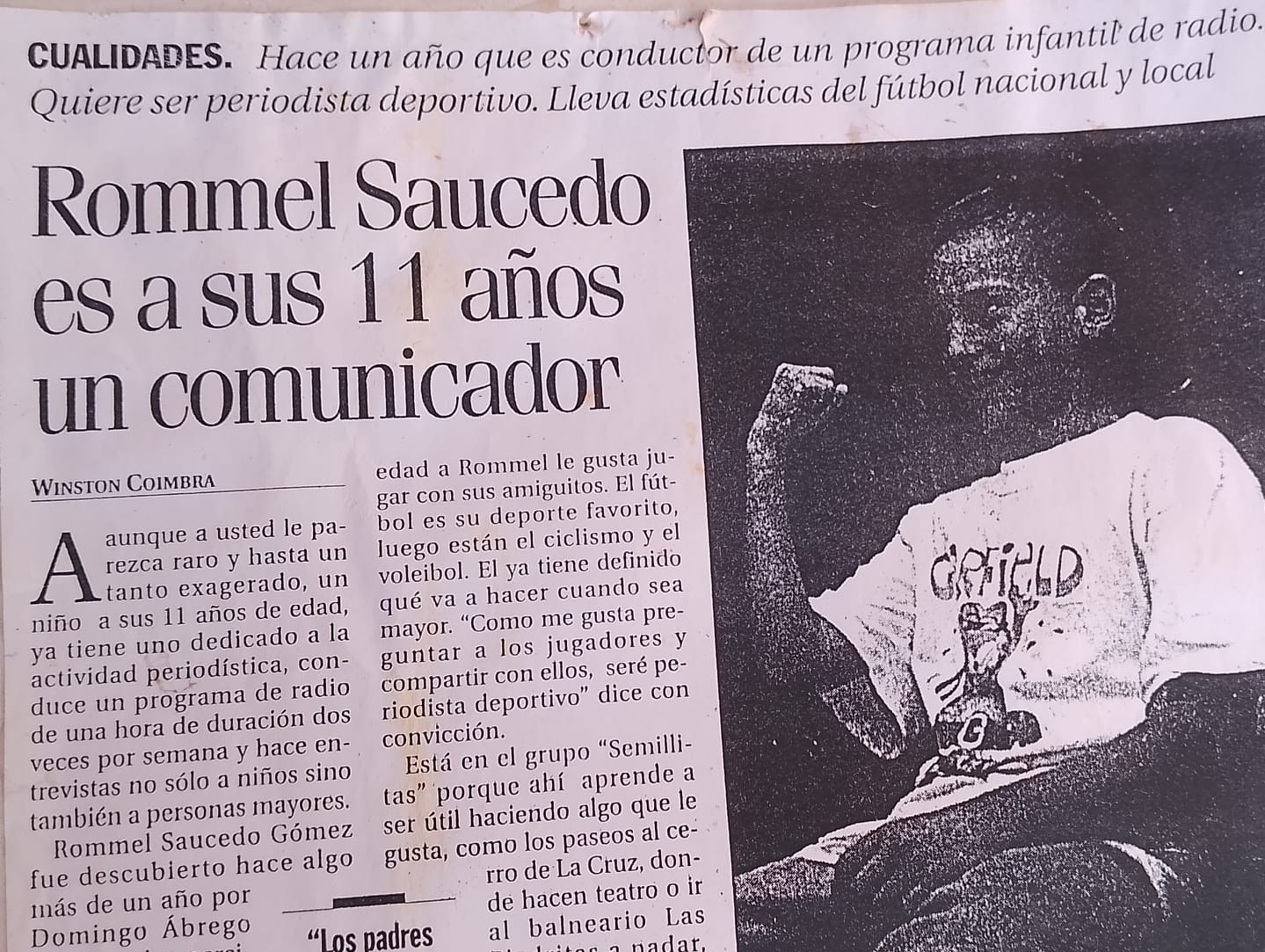
Als 22jähriger Stadtrat war er dann in der Tieflandprovinz San Ignacio de Velasco in einen kommunalpolitischen Machtkonflikt und deshalb in die Mühlen der Justiz geraten. 14 Monate hatte er selbst in Untersuchungshaft verbracht, bevor die Anzeige wegen versuchten Mordes gegen ihn zurückgenommen wurde.
Trendwende auch in der Land- und Umweltgerichtsbarkeit
Wäre nur vorauseilender Gehorsam gegenüber der im November antretenden neuen Regierung der Grund für die veränderte Rechtsprechung, und nicht auch ein größerer Handlungsspielraum der Gerichte, dann ließen sich zahlreiche Urteile in Landfragen und der Umweltrechtsprechung in der jüngeren Zeit nicht erklären. Etwa das Urteil des Verfassungsgerichts im Juli, das die Rückgabe von 54.000 Hektar Gemeindelandes an die ansässigen Tsimane im Beni angeordnet hat. Es handelt sich um Land, das von Migranten aus dem Hochland besetzt worden war (siehe auch diesen früheren Beitrag “Schlussverkauf” auf Latinorama). Oder die Entscheidung eines Agrargerichts im August, die weitere Behandlung der Verträge mit russischen und chinesischen Konzernen über die Lithium-Ausbeutung auszusetzen, bevor nicht die vorgeschriebene Umweltprüfung sowie Information und Befragung der lokalen Bevölkerung durchgeführt worden sei. Die Regierung hatte argumentiert, man wisse ja noch gar nicht, wo genau das Lithium abgebaut werden solle. Das könne erst nach Vertragsunterzeichnung geklärt werden.
Bereits Ende 2024 hatte das Verfassungsgericht eine Klage des bolivianischen Vizepräsidenten David Choquehuanca und des Senatspräsidenten Andrónico Rodriguez zurückgewiesen, mit der diese den Landkreisen Palos Blancos und Alto Beni im subtropischen Norden von La Paz die Kompetenz absprechen wollten, ihre von der ökologischen Landwirtschaft geprägten Regionen von der Bergwerkswirtschaft frei zu halten.

SILKE KIRCHHOFF | gefördert von der Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst
Bergwerksfreie Munizipien
Davon beflügelt sah sich wohl Anfang September auch der Bürgermeister von Viacha im Altiplano nahe La Paz und im Einzugsgebiet des Titikaka-Sees. Nach Protesten der kleinbäuerlichen Bevölkerung ordnete er die Schließung eines Großteils der 23 Bergwerksbetriebe im Munizip an. 21 von ihnen, darunter ein chinesisches Unternehmen, hatte nicht einmal eine Betriebsgenehmigung und die gesetzlich vorgeschriebene Umweltprüfung durchgeführt. Trotzdem folgten Drohungen gegen die Sprecher der von den Giften geschädigten 60 Landgemeinden. Und erst jetzt auch ein Versprechen: Die Abfälle künftig in Rückhaltebecken zu speichern, statt die Gewässer und Böden mit Zyanid, Quecksilber und anderen Schadstoffen zu kontaminieren.
„In den letzten beiden Monaten lässt sich ein Wandel in der Justiz erkennen“, sagt Rubén Ticona Quisbert. Er ist Ökonom und Mitglied der Aktionsgruppe „Kämpfe für den Amazonas“ (siehe auch dieses Porträt der Mitgründerin Daniela Arratia auf Latinorama). „Da die Regierung die Mehrheit im Parlament und nun auch noch die Wahlen verloren hat, spüren viele Richter und Richterinnen nicht mehr diesen politischen Druck, Entscheidungen zugunsten der Bündnispartner der Regierung zu treffen, seien es Bergwerkskooperativen, Agroindustrielle oder die Siedler, die sogenannten Interkulturellen, die praktisch für nichts Land zugesprochen bekommen.“

Ich spreche mit Ticona während einer Mahnwache vor dem Parlamentsgebäude in La Paz. Am obersten Agrargericht in Sucre wird gerade über eine Klage von sieben Umweltschützerinnen gegen die Behörden verhandelt. Ziel ist es, die Zentral- und Lokalregierungen zu Maßnahmen gegen die Waldbrände zu verpflichten, die in Bolivien jedes Jahr zu mehr Verwüstung, Luftverschmutzung und dem Tod zigtausender Tiere führen (siehe diese Zusammenfassung einer aktuellen Studie der Stiftung Tierra auf Latinorama).
Großagrarverbände wie auch zig Ministerien hatten in trauter Einigkeit im Vorfeld der Anhörung versucht, das Verfahren zu stoppen. Vergeblich. Alle Einwände wurde vom Gericht abgelehnt, das den Klägerinnen und den sie unterstützenden Umweltverbänden stattdessen Zeit einräumte, ihre rechtlichen Argumente und Untersuchungsergebnisse auch mündlich vorzubringen.

Ein Gerichtsurteil gegen die Waldbrände
„Letztes Jahr konnte man in der Stadt Santa Cruz vor lauter Rauch nicht einmal mehr das gegenüberliegende Haus erkennen“, berichtet Ticona Quisbert. Das Hauptproblem sei, dass die Regierung der MAS in den ganzen Jahren Land an Siedler vergeben habe, das diese aber nicht bearbeitet, sondern – vor allem an große Agrarbetriebe – weiterverkauft hätten. Ziel der Klage vor dem obersten Agrargericht ist daher vor allem, die Gesetze, die das Abbrennen von Wald erleichtern, annullieren zu lassen und die sogenannte ökologische Pause wieder in Kraft zu setzen. Das heißt, das illegal abgefackelte Wälder mindestens fünf Jahre Zeit zur Erholung bekommen sollen und derweil nicht als Anbaufläche für Monokulturen oder andere Nutzungen verwendet werden dürfen. Das oberste Agrartribunal gab schließlich den Klägerinnen recht und den staatlichen Stellen 48 Stunden Zeit, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

„Es ist ein historisches Urteil“, kommentierte der Umweltökonom Stasiek Czaplicki in der Zeitschrift Nómadas. „Aber alleine wird es die Regierungspolitik und das exportorientierte Agrarmodell nicht verändern. Das Parlament ist bestimmt von den Interessen der Agrarindustrie und wird sich von Gerichtsurteilen nicht beeindrucken lassen. Die Regierung hat sich als passiv erwiesen. Und die Legitimitätskrise der Justiz wird nur überwunden, wenn dem Urteil auch Taten folgen.“ Und das hänge in großem Umfang vom Druck der Öffentlichkeit ab, so Czaplicki.
Auch der Fachkollege Ticona ist skeptisch: „Die Justiz richtet sich immer nach der jeweiligen Regierung aus. Wenn Jorge Quiroga die Wahl gewinnt, dann kommen dunkle Zeiten auf die Umweltbewegung zu“, meint der Ökonom Ticona in Bezug auf die Vorstellung Quirogas, dass nur individueller Landbesitz geeignet sei, die Natur zu schützen. Deshalb, so Quiroga, sollten keine kollektiven Landtitel mehr vergeben werden. Um so wichtiger sei es jetzt, betont Ticona, die indigenen Gemeinden, ihre gemeinschaftlichen Landrechte sowie ihre Autonomie und Produktion zu verstärken, damit Bergwerksbetriebe und Großagrarier ihnen ihre Ländereien nicht abkaufen oder sie sich anderweitig aneignen.
Weder komplette Unabhängigkeit der Justiz noch umfassende Straflosigkeit
Die Verwirklichung der Menschenrechte wird immer auch abhängig vom sozialen Umfeld und zivilem Engagement sein, und die Justiz nie ganz unabhängig von der jeweiligen Regierung. Deshalb ist auch nicht zu erwarten, dass nach den Jahrzehnten der Instrumentalisierung der Justiz gegen Oppositionelle nun eine Phase der Straflosigkeit droht, wie die Justizministerin beklagt. Das zeigt schon die Rückkehr von Arturo Murillo nach Bolivien. Der frühere Innenministers von Jeanine Añez war in die USA geflohen. Nach einem Verfahren und einer Verbüßung einer Strafe wegen Geldwäsche ist er nun wieder nach Bolivien ausgewiesen worden. Und derzeit gibt keine Anzeichen von Sympathie in der Bevölkerung und Nachsicht in der Justiz für die millionenschweren Bestechungsgelder, die er beim Einkauf von großen Mengen an Tränengas und anderem Material persönlich eingesteckt hat, die dann bei der Niederschlagung der Aktionen der Anhänger*innen von Evo Morales eingesetzt wurden. Auch in Bezug auf die Toten von Sacaba und Senkata wartet ein Verfahren auf Murillo. Als er ins San Pedro-Gefängnis gebrachte wurde, meinte er nur, froh zu sein, zurück in Bolivien dem Niedergang der MAS beiwohnen zu können.
Ein ehemaliger Kollege, der Wirtschaftsminister aus der gleichen Regierung, wurde gerade zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Ohne Parlamentsbeschluss hatte er auf Sonderziehungsrechte des Weltwährungsfonds zurückgegriffen, um die Sonderausgaben für die COVID-Maßnahmen abzudecken. Da es Gelder gewesen seien, die Bolivien selbst beim IWF hinterlegt hatte, sei kein Parlamentsbeschluss nötig gewesen, so wie bei gewöhnlichen Auslandskrediten, argumentiert der Ex-Minister. Das Gericht war anderer Meinung.

Straflosigkeit wird es auch aus einem anderen Grund nicht geben. Jedenfalls nicht für alle diejenigen, die bislang unter dem Schutzschirm der Macht gestanden haben. Gegen Präsident Luis Arce wurde von der ehemaligen Chefin der Bergwerksaufsicht eine Vaterschaftsklage eingereicht. Gegen die heute 33jährige selbst läuft eine Entschädigungsklage eines ehemaligen Mitarbeiters ihrer Presseabteilung, den sie wegen eines umstrittenen Memes hatte inhaftieren lassen. Arce könnte noch ein weiteres Verfahren wegen Amtsmissbrauch erwarten, wenn eine aktuelle Justizpraxis fortgesetzt wird: Die gleiche ehemalige Direktorin der Bergwerksaufsicht hatte bei der Einstellung nicht die in der Ausschreibung genannten Bedingungen erfüllt, sprich Erfahrung im Sektor. Auch gegen einen der Söhne und die Tochter von Luis Arce wurde inzwischen eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung wegen Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit einem Millionenkredit für den Kauf eines Agrargutes eröffnet. Sie werden nicht die Einzigen bleiben. Nur ob Evo Morales, der sich einstweilen in der Kokahochburg Chapare verbarrikadiert hat, irgendwann einmal vor Gericht erscheinen wird, das steht trotz markiger Ankündigungen des Präsidentschaftskandidaten Jorge Quiroga und allgemeiner Rechtsstaatsbekenntnisse seines Konkurrenten Rodrigo Paz noch in den Sternen.