Am 12. Oktober erinnern wir den Jahrestag des Beginns der europäischen Eroberung Amerikas oder Abya Yala. Mit Schwert, Kreuz und Krankheiten wurden Kolonialreiche vor allem zur Ausbeutung der Reichtümer errichtet. Dass der Chiquitano Roberto Claudio Tomichá Charupá von einer Aneignung des Christentums durch sein indigenes Volk spricht, hat nichts damit zu tun, dass er selbst katholischer Theologe ist. Dagegen eher damit, dass die Reduktionen der Jesuiten in Chiquitos im 18. Jahrhundert, zu denen der Franziskaner an der päpstlichen Universität in Rom promoviert hat, eine vergleichsweise gewaltfreie Form der Missionierung waren. Es hat aber vor allem auch mit der Dekolonialisierung des Denkens zu tun.
Und die beinhaltet neben der Erinnerung an die Gräueltaten und neben der Wiedergewinnung der eigenen Wurzeln auch, die Indigenen nicht auf die Opferrolle zu reduzieren. Tomichá ist Mitglied eines Netzwerk indianischer Theologie. Dort wird das Christentum aus den indigenen Kulturen heraus interpretiert. Latinorama sprach mit dem Direktor des Instituts für Missionswissenschaften der Katholischen Universität von Cochabamba im September 2022 zu seinem Ansatz und vor allem zu seiner indigenen Herkunft, die dabei eine wichtige Rolle spielt.

Ich bin 1964 geboren. Von meinen Wurzeln her bin ich Chiquitano. Meine Familie kommt aus San Miguel de Velasco. Sie hat mir die dortige von den Jesuiten-Missionaren und später den Franziskanern geprägte indigene Kultur mitgegeben. Als ich noch klein war und in die Schule kam, sind wir in den Norden von Santa Cruz in die Region von Montero und Warnes gezogen. Nur meine größere Schwester blieb im Dorf. Aber immer wenn wir konnten, sind wir nach San Miguel zurück gekehrt, vor allem zum Dorffest, in den Schulferien zum Jahresende und in der Karwoche.
Wie ist der Einfluss der Jesuiten-Missionare im 18. und der Einfluss der Franziskaner im 20. Jahrhundert einzuschätzen? Haben die Chiquitano in den Reduktionen ihre kulturelle Eigenart bewahrt? Oder handelt es sich heute vielmehr um eine mestizische, eine Misch-Kultur?
Die große Mehrzahl der indigenen Völker in Amerika wurden im Laufe der Geschichte aus Europa beeinflusst. In Bezug auf die Religion vor allem durch das Christentum, insbesondere den Katholizismus, später auch durch evangelische Gruppen.

Die indigenen Völker des heutigen bolivianischen Tieflands hatten – abgesehen von den wenigen in Isolation lebenden Gruppen – bereits vor der Kolonialzeit auch Kontakte und Austausch untereinander und mit Kulturen aus dem Andenbergland. In der Region, aus der ich komme, entstand mit der Ankunft der Missionare ein Prozess der kulturellen Aneignung ihrer Lebensweise und auch der Religion. Die Christianisierung liegt jetzt mehr als drei Jahrhunderte zurück. Und die Frage ist berechtigt, was von der ursprünglichen Kultur geblieben ist. Wenn auch nicht in expliziter Form, so ist sie gewiss noch in den Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und in Ritualen präsent, im Gesang der Vögel, in der Gewissheit, dass es in Wäldern Jichis gibt. Das sind die Wesen, die dich beschützen, auch wenn du sie bisweilen fürchtest.

Kindheit inmitten der Natur
Welche Erinnerungen haben sie an ihre Kindheit in San Miguel?
Ich erinnere mich an das alltägliche Familienleben auf dem Land. Ich wuchs inmitten der Natur auf, die viel Raum für Imagination gab. Damals habe ich erfahren, dass man nicht in der Natur lebt, um sie zu beherrschen. Die Natur ist Teil von einem selbst und man selbst Teil des Waldes, der Pflanzen oder Flüsse und Teiche. Die Tiere sind Lebewesen so wie du selbst. Meine Familie war zwar katholisch, aber was das Christentum im Besonderen ausmacht und wie sich das sprachlich ausdrückt, das habe ich erst im Religionsunterricht in der Schule entdeckt und später bei der Erstkommunion kennen gelernt.

Das Familienleben war recht patriarchalisch. Nicht alles, was ich damals in der Familie mitbekommen haben, ist auch heute noch von Nutzen. Jede Kultur sollte im Austausch mit anderen Kulturen lernen, um sich zu verbessern. Dazu gehören auch Beiträge aus den westlichen Gesellschaften oder des Christentums. So ist es auch bei mir. Ich habe meine Chiquitano-Kultur geerbt. Ich habe aber auch von anderen Sichtweisen aus Europa, Afrika, Asien oder anderen indigenen Völkern der Region gelernt. So wie ich es in meiner Familie erfahren habe, die auch offen für andere Kulturen war.
Die Bibel ebenso wie indigene Weisheiten und Legenden
Die Konfrontation mit fremden Kulturen war anscheinend keine traumatische Erfahrung für Sie?
In meinem Fall nicht. Auch wegen all dem, was ich zu Hause vor allem von meinem Vater gelernt habe in Bezug auf die Arbeit, auf Hingabe und Fleiß, auf die Art zu kommunizieren, die Mitarbeit im Haushalt, die Wertschätzung des Wissens. Bevor ich in die Schule kam, hat er mir schon das Schreiben und die Uhrzeit beigebracht. Bevor wir uns endgültig in der Zuckerfabrik Guabirá in Montero niederließen, besaß er nur zwei Bücher: Eine dicke evangelische Bibel und ein neues Testament mit dem Titel „Gott kommt zu den Menschen“, das damals von US-Sekten verteilt wurde. Auch mit der Tageszeitung habe ich lesen gelernt, wenn mein Vater mit einem Exemplar aus der Stadt zurück kam.
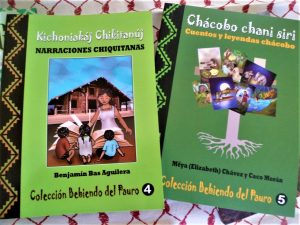
Er erzählte mir aber auch von den Schutzwesen der Flüsse und der Bäume, von traditionellen Weisheiten und Legenden. Einige von ihnen haben wir jüngst in einer Broschüre veröffentlicht.
Was ich vor allem von meiner Familie erlernt habe ist das Eingebunden sein in die Umgebung, die Großzügigkeit und die Gastfreundschaft. Mein Vater war sehr offen, obwohl sie immer schauen mussten, mit dem Vorhandenen selbst auszukommen. Wer auch immer aus San Miguel zu uns nach Hause kam, wurde aufgenommen und untergebracht. Sie blieben häufig dann, gingen zur Arbeit so wie ein weiteres Familienmitglied. Gearbeitet wurde nicht, um Besitz anzuhäufen, sondern um die Früchte zu teilen. Manchmal gab es Diskussionen mit meiner Mutter, die aus gutem Grund mehr an die Zukunft dachte.
Die Schulzeit: Manchmal ist Ignoranz auch hilfreich
Damals gab es noch kein Gesetz, das die interkulturelle Bildung vorschreibt. Wie haben sie die Schule erlebt?
Gott sei Dank arbeitete mein Vater damals im Rahmen eines Projektes der staatlichen Corporación Andina de Fomento zur Förderung des Milchviehs. Das lag neben der Zuckerfabrik von Guabirá, bei der er später auch gearbeitet hat und die eine für die damalige Zeit recht gute Schule hatte. Mit sechs Jahren bin ich dort hingekommen. Es gab eine Bibliothek. Es war meine erste Begegnung mit einer anderen Welt. Die Schüler*innen kamen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten und sozialen Schichten. Und manchmal ist Ignoranz auch hilfreich. Da meine Augen ein wenig asiatisch aussehen, glaubten viele, dass ich aus einer der japanischen Siedlungen in der Nähe käme. Ein „Chinese“ zu sein, wie es allgemein hieß, hat mich vor Diskriminierung bewahrt. Chinesen, oder Japaner hatten sogar noch einen höheren Status als der des Camba. Andererseits habe ich damals meine Identität versteckt. Einmal im ersten oder zweiten Schuljahr hatte ich auf meinem Pult mein Heft mit der Seite offen, auf der ich eine Reihe von Besiró-Begriffen aufgeschrieben hatte, die ich von meinem Vater gelernt hatte. Und meine Lehrerin fragte in einem etwas verächtlichen Ton, was das denn zu bedeuten habe? Ich sagte ihr, dass das unser „Dialekt“ sei. So nannte man die Sprache der Chiquitano damals. Danach habe ich in der Schule nicht mehr gezeigt, was ich an Besiró gelernt hatte. Damals schien mich das nicht besonders zu stören. Aber rückblickend denke ich, war es ein heftiger Einschnitt. Später bin ich auf die Sekundarschule in Montero gegangen. Aber auch da habe ich mich angepasst. Meine Chiquitano-Kultur erfuhr ich nur im familiären Rahmen und bei den Besuchen in San Miguel. Ich lebte in zwei parallelen Welten. Das habe ich auch von meinem Vater gelernt. Seine Überlebensstrategie war, allen Gehör zu schenken und sich in keinen Konflikt hineinziehen lassen.

Streng und doktrinär: Kommunionsunterricht bei polnischen Priestern
Wo war die katholische Religion in dieser Zeit angesiedelt? Bei den Chiquitano oder in der Parrallelwelt?
Das Sakrale wird auf Besiró Paí-Tupa genannt. Dieser Begriff bedeutet wörtlich übersetzt „Vater-Gott“ und stand für mich und meine Familie immer für das, was uns, unser Tun und das Leben aufrecht erhält. Deswegen sollten wir uns für das Wenige, was wir hatten, dankbar zeigen. Selbst in schwierigen Situationen, wenn jemand krank wurde und in Augenblicken der Ungewissheit war immer diese religiöse Dimension präsent. Meine Eltern waren praktizierende Katholiken, die zur Messe gingen. Diese Riten sind für die Chiquitano zum Teil ihrer Kultur geworden. Auch hatte ich selbst in der Bibel gelesen und das Gefühl, nicht allein zu sein. Aber ich habe das damals nie in Worte fassen können, bis ich im Alter von zwölf Jahren zum Kommunionsunterricht bei polnischen Missionaren in unserem Ort Guabirá geschickt wurde.

Gab es Offenheit bei den polnischen Missionaren für die Chiquitano-Kultur?
Damals lernte ich ihre Art kennen, das Christentum zu verstehen. Die unterschied sich sehr von meiner eigenen Erfahrung. Als Jugendlicher hatten die Organisation und der moralische Anspruch auch etwas Anziehendes. Die Missionare organisierten zudem Jugendtreffen, Ausflüge, Musikveranstaltungen, Einkehrtage mit anderen Jugendlichen. Ich wollte dieses Leben einfach einmal ausprobieren, um zu sehen, ob vielleicht etwas Interessantes dabei ist. Aber es war auch sehr streng und doktrinär. Wenn du wirklich willst, dachte ich mir, dann kannst du auch diesen Weg beschreiten. Aber am Ende wurde mir klar, dass dieser Katholizismus mir nicht weiter helfen würde, weil er mich von meiner Familie und Kultur entfremdete.
Student an der Universität: Von Chemie und Programmieren zur Theologie
Wie kam es dann zu der Entscheidung, Theologie zu studieren und Franziskaner zu werden?
Nach meinem Abitur bekam ich ein Stipendium der Zuckerfabrik und studierte zwei Jahre lang Chemieingenieur an der staatlichen Universität von Santa Cruz. Das war zunächst viel Mathematik. Mit einem Stipendium der Regierung lernte ich auch Programmieren. Das gefiel mir. Ich hatte immer schon ein Faible für Präzision und Genauigkeit. Und die Physik und Mathematik boten mir diese Exaktheit.

Während der ganzen Zeit traf ich mich aber auch weiter mit den Jugendlichen der kirchlichen Gruppe in Montero. Da waren ältere dabei, die nach Argentinien zur Fortbildung bei den dortigen Franziskanern gefahren waren und davon erzählten. Auch wenn ich dachte, dass die religiöse Seite nichts für mich sei, klang das interessant. Ich wollte ohnehin einmal andere Länder kennen lernen. Als ich nach Buenos Aires kam, war ich 19 Jahre alt. Bei den dortigen Franziskanern traf ich auf eine ganz andere Theologie. Man nannte es die „Theologie des Volkes“. Mit der Theologie der Befreiung lernte ich eine andere Sicht auf das Leben, auf die Geschichte und eine andere Bibelinterpretation kennen. Ich entdeckte die Vielfalt der Personen und ihrer Sichtweisen in der Kirche. Und die Mitglieder der Franziskanergemeinschaft von Buenos Aires nahmen mich offen auf und ließen mir meinen Spielraum und meine Freiheit, beides Dinge, die ich auch bei meinen Eltern geschätzt habe. Ich erlebte diese Spannungen zwischen dem Leben und aktiven Handeln, zwischen der gemeinschaftlichen Kultur und der individuellen Persönlichkeit, zwischen den persönlichen Bindungen und den Utopien.

Erst später sollte es mir mit der Rückgewinnung meiner indigenen Wurzeln gelingen, all das in Übereinstimmung zu bringen und ich selbst zu sein. Da war ich aber bereits fast 30 Jahre alt.
Menschen aus aller Welt: An der päpstlichen Universität in Rom
Da promovierten sie in Rom an der päpstlichen Gregoriana. Das ist nicht unbedingt ein Ort, von dem man die Rückbesinnung auf die indigenen Wurzeln erwarten würde.
Diesen Wiederentdeckungsprozess habe ich eher selbst und am Rande der Institution durchgemacht. Ich denke, außer meinem Vater bin ich keinen Vorbildern gefolgt, sondern eher ein Autodidakt. Oder vielleicht besser gesagt: Ich hatte unterschiedliche Lehrer, denen ich zugehört habe. Von jedem habe ich etwas anderes gelernt. Europa hat mir dabei geholfen, die Vielfalt im Christentum wahrzunehmen. Ich denke da an Johann Baptist Metz oder an Drewermann mit seiner Kritik an der Rolle der Priester in Deutschland. Und in Rom kamen sie noch aus allen anderen Kontinenten zusammen. Jede Person kann aus ihrer Perspektive viel beitragen. Und da fragte ich mich natürlich, was ich selbst denn Eigenes beizutragen hätte. Und das erforderte, meine Wurzeln und die Geschichte zu studieren, die Sprache zurückzugewinnen.
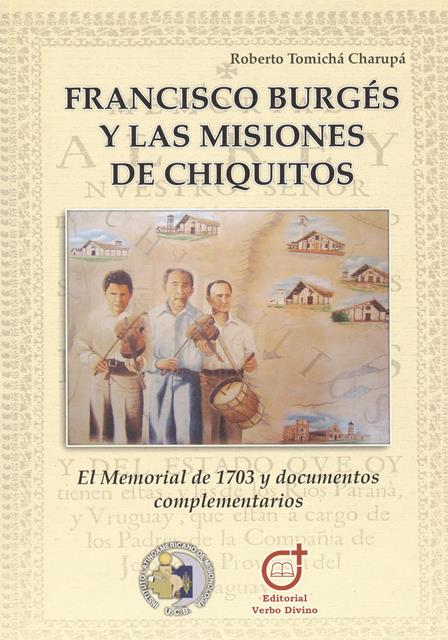
Ich begann, im Jesuiten-Archiv in Rom und im „Indienarchiv“ von Sevilla zu forschen. In Paris war ich auch in der Nationalbibliothek, in der es eine Reihe Dokumente zu Chiquitos gibt. Nur nach Berlin in das Iberoamerikanische Archiv bin ich nicht gekommen. Bei dieser Suche nach den Wurzeln wurde mir klar, dass die Verfolgung meiner Ideale mit meiner ganz konkreten Persönlichkeit zu tun hatten, in der ich alle Einflüsse und Anliegen zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen musste.
Andere Kulturen und sich selbst besser verstehen
Das ist gewiss eine der schwierigsten Herausforderungen in modernen oder post-modernen Gesellschaften
Ich habe in der Gregoriana hochqualifizierte Professoren kennengelernt, die wenig menschlich im Umgang waren. Wie ist das möglich, habe ich mich gefragt, wo sie doch so intelligent sind? Wir erlebten sie eher aus der Distanz. Dadurch wurde mir um so klarer, dass ich von meinen eigenen Wurzeln ausgehen musste. Ich interessierte mich für Psychoanalyse und als Franziskaner auch für das Mittelalter. Wie im 12. Jahrhundert die Ordensgemeinschaften entstanden waren, wie sie die Bibel gelesen hatten und wie sich dort Männer und Frauen begegnet waren. Die mystischen Texte habe ich auch gelesen, aber die sozialen und kulturellen Aspekte interessierten mich mehr. Ich suchte Antworten auf die Frage, wie im täglichen Leben Diskriminierung verhindert werden kann. Zum Studium der Missionswissenschaften kamen neben der Theologie auch die Fächer Geschichte und Anthropologie hinzu. Das war für mich eine Brücke zu anderen Kulturen der Erde, zur Rückgewinnung der eigenen Kultur und um mich selbst besser zu verstehen.

Sie sind Direktor des Missionsforschungs-Instituts der Katholischen Universität von Cochabamba und Mitglied eines lateinamerikanischen Netzwerks indianischer Theolog*innen
Das Institut wurde 1994 von der Bischofskonferenz mit der Idee gegründet, im Dialog mit den vielen Kulturen und der Geschichte Boliviens Theologie zu betreiben. Vieles lag damals in den Archiven und war nicht bekannt. Außerdem sollten einreisende Missionare hier eingeführt werden. Ich bin seit 2003 am Institut. Dort wurde auch schon vorher über die indianische Theologie veröffentlicht. Der Begriff wird seit einer ökumenischen Tagung 1990 in Mexiko benutzt. Der Zapoteke Eleazar López hatte damit begonnen. Er unterscheidet die ureigene indigene Theologie von der christlichen indigenen Theologie, die das Christentum aus der eigenen angestammten Kultur heraus interpretiert. Ich bin seit 2006 Teil dieser Bewegung. Wir sind alle Christen, aber jeder liest die Inhalte aus der eigenen Kultur heraus mit dem eigenen Wissen, der eigenen Sprache und den eigenen Symbolen.
Indigene Theologien und das europäische Christentum
Eine monotheistische, patriarchale Religion scheint sehr weit weg von den indigenen Kulturen des Tieflandes, wo die ganze Natur beseelt ist.
Genau das sagen wir. Das Mysterium wird in den Dogmen aufgrund einer bestimmten Kultur in einer spezifischen Sprache mit den für die jeweilige Epoche typischen Symbolen ausgedrückt. Weil es aber über all das hinausgeht, kann es mit anderen kulturellen Schlüsseln neu interpretiert werden, ohne die Gültigkeit des Dogmas anzuzweifeln. Und wenn wir die Bibel und die ersten Jahre der Christenheit erforschen, stellen wir auch dort bereits eine große Vielfalt fest. Griechenland, Rom, Karthago, Syrien… Mit der Kolonialisierung ist ein spezifisches iberisches Christentum in unsere Region gekommen.
Auch ein alpenländisches Christentum, wenn man die Herkunft der Jesuiten in den Chiquitos-Missionen berücksichtigt.
Viele kamen aus Mitteleuropa. Wenn man sich deren kulturellen Kontext anschaut, dann eröffnet genau das den Blick für indigene Interpretationen oder Ausdrucksformen des Mysteriums. Das ist keine leichte Aufgabe und wird von vielen auch nicht akzeptiert.

Roberto Tomichá zeigt einer seiner Veröffentlichungen, hier zum Wirken des Geistes in indigenen Völkern, Foto: P.Strack
Es geht um Dialog und nicht darum, Definitionen festzulegen
Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Nehmen wir den Heiligen Geist. Was bedeutet das in einer indigenen Kultur? Zuerst einmal gibt es diese dort meist im Plural. In Nordamerika ist dagegen vom „Großen Geist“ die Rede. In der andinen Welt kommt der Begriff des Ajayu (eine Art Seele und Lebensmut) am nächsten. Kommt darin etwas von dem zum Ausdruck, was in der katholischen Doktrin als Heiliger Geist bezeichnet wird? Letztlich gibt jede Kultur seinen Geistern ihre eigenen Bezeichnungen und Bedeutungen. Ob sie zur Begleitung oder zum Schutz dienen… Im Alten Testament gibt es auch unterschiedliche Begriffe und Bedeutungen: Ruah als Wind oder Atem. Im neuen Testament bedeutete es dann Anwesenheit, Feuer… All das lässt sich gegenüberstellen. Es geht um den Dialog, den Austausch, nicht um die Festlegung einer Definition.
Zahlreiche Kulturen – so wie die meine – haben nicht das Bedürfnis, alles verstehen zu müssen. Für sie ist es wichtiger, zusammen zu sein, den Wald oder die Welt zu betrachten, sich auszutauschen oder einfach erstaunt zu sein über das Mysterium.
Sich mit anderen für die Stärkung der indigenen Kulturen einsetzen
Wir sprechen über all dies, während in der Chiquitanía die Wälder brennen. Und mit den Wäldern geht auch ein Stück weit die Kultur, das angestammte Wissen und diese Weltsicht verloren. Die Brände werden teilweise von Menschen aus anderen Landesteilen absichtlich gelegt und sind Teil eines wirtschaftlichen Konfliktes. Hat das alles auch mit einem mangelnden Verständnis der aktuellen Regierung für die indigenen Kulturen des Tieflandes zu tun?
Deshalb arbeiten wir mit anderen zusammen, um die Geschichte und Kultur der indigenen Völker des Tieflandes zu dokumentieren. Damit wollen wir die Weisheit und das Wissen der Völker der Amazonas- und der Chaco-Region bekannter machen. Dass es diese Bücher inzwischen gibt, heißt jedoch nicht, dass sie auch gelesen werden, geschweige denn, dass ihr Inhalt akzeptiert wird. So findet dieses Wissen in der Politik kaum Berücksichtigung. Oder es wird nur dazu benutzt, die eigenen Sichtweisen und Interessen auf Kosten der indigenen Völkern durchzusetzen. Hier spielen auch internationale Interessen politischer, sozialer oder wirtschaftlicher Art eine Rolle, die tief in die indigenen Gemeinden eingedrungen sind, bis hin zum Drogenhandel.

Die Situation im Tiefland ist mit den illegalen Landbesetzungen durch Siedler aus dem Hochland, mit den Waldbränden, mit der Abwanderung der Jugend aus den indigenen Gemeinden und dem Verlust traditionellen Wissens höchst ungewiss. Und die politische Polarisierung ist nichts, was den indigenen Völkern des Tieflandes liegt. Ihnen fehlen mehr Erfahrungen und Strategien, sich erfolgreich gegen die Übergriffe wehren zu können. Aber all das nimmt uns nicht die Motivation, uns mit anderen für die Stärkung dieser Kulturen einzusetzen, wo auch immer sich eine Gelegenheit ergibt.



