Das folgende Interview mit mir in der Zeitschrift der DIDF-Jugend »Junge Stimme« erschien in der Ausgabe März/April 2020. Ich bedanke mich für das freundliche Gespräch.
JS: Hallo Mesut, könntest du dich kurz vorstellen bitte?
MB: Mein Name ist Mesut Bayraktar, ich wurde 1990 in Wuppertal geboren und bin dort aufgewachsen. Nach der Schule bin ich zufällig in ein Jurastudium gerutscht. Die Disziplin, die Arbeiterfamilien eigen ist, ich kenne sie von Zuhause, hat mich dazu gezwungen, das Studium mit einem Abschluss zu beenden. Anschließend habe ich angefangen Philosophie zu studieren. Seit ich die Literatur für mich gefunden habe, weiß ich, was meine Aufgabe ist.
JS: Wie bist du auf die Literatur gekommen, wie hast du angefangen zu schreiben? Das ist etwas Ungewöhnliches für türkeistämmige Jugendliche.
MB: Ich könnte diese Geschichte aus vielen Seiten aufziehen, will aber nur ein Gesichtspunkt aufwerfen. Die Scham. Sie hat mich dahin gebracht zu schreiben. Diese Scham hat mich in der Schule immer wieder auf meine sprachlichen Defizite hingewiesen. Manchmal hat das ein schreckliches Gefühl hinterlassen und manchmal habe ich das zurückgewiesen mit einem Stolz, der meine Schwächen verdecken sollte. Zuhause gab es keine Bücher und zuhause war auch niemand geschult darin, zu schreiben und zu lesen. Aber diese Scham, dass man mal was Falsches sagt, dass man den falschen Artikel benutzt, hat in mir eine Polizei erzeugt, eine Sprachpolizei, die mich immer darauf hingewiesen hat: „Hey, sprichst du da richtig oder falsch Deutsch? Ist die Grammatik richtig oder falsch?“ Die Scham, die mich befragte, war im Grunde genommen die Gesellschaft. Sie war immer da. Niemand will in Situationen geraten, in denen alle über dich lachen. Deswegen achtest du doppelt auf deine Wortwahl. Beim Sprechen überlegst du, welcher Artikel für das Wort, das du gleich benutzen wirst, richtig ist, und du überlegst gleichzeitig, was du sagen willst, während du sprichst. Solchen Situationen bin ich oft begegnet. Ich kenne viele, denen es so geht. Das raubt Kraft, aber es trainiert dich. Ich war 18, da schenkte mir dann eine Freundin das Buch von Orhan Pamuk „Istanbul“. Das war ein Geburtstagsgeschenk, kein besonderes Buch, aber mein allererstes, das ich nicht wegen der Schule in den Händen hatte. Ich habe mir vorgenommen, es zu lesen, und ich hatte es geschafft. Ich wollte der Scham auf ihrem Gebiet zeigen, dass sie nicht übermächtig ist. Du siehst wie spät, und plötzlich habe ich die Sprache für mich kennengelernt. Ich war nicht mehr allein. Ich habe die Sprache als eine Heimat der Heimatlosen entdeckt. Ich konnte es mit der Scham aufnehmen. Irgendwann habe ich dann durch die übliche, ja ich möchte fast sagen, proletarische Naivität einfach mal ein Stift in die Hand genommen und gesagt: „Jetzt schreibe ich. “ Freunde gaben mir Mut, an die Öffentlichkeit damit zu treten. Ich habe an Wettbewerben teilgenommen und man hat mir nach und nach bescheinigt: „Der Junge versteht vielleicht doch was von Literatur“. Letztlich war es also die Sprache, die mich angeleitet hat, mich der Scham zu stellen. Das tut sie bis heute.
JS: 2018 ist dein erster Roman „Briefe aus Istanbul“ erschienen. Der Titel lässt vermuten, dass das Buch über die Türkei oder Türkeistämmige ist, überraschenderweise geht es in deinem Roman um das Thema Flucht. Was hat dich zu diesem bewegt?
MB: Das Thema Flucht hat mit einer praktischen Erfahrung zu tun. Als viele Menschen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, vor allem im Nahen Osten aus Syrien, kam es zu dieser zivilgesellschaftlichen Solidarität, den Vertriebenen eine Hand zu reichen, damit ihnen nicht das widerfährt, was vielen migrantischen Gruppen in der Vergangenheit widerfahren ist, auch in Deutschland. Ich war in Wuppertal bei der Initiative „Refugees Welcome“. Ich habe dort eine randständige Rolle gespielt. Dort bin ich mit vielen Menschen aus Syrien ins Gespräch gekommen. All diese Erfahrungen haben mich letztlich zu dem Buch bewogen. Ich musste das irgendwie verarbeiten. Ich konnte damit nicht mehr ruhig schlafen gehen. Da war eine initiale Erfahrung auf einer Musikveranstaltung, die wir organisiert haben. Ich habe gemerkt, dass ein Kind die ganze Zeit an der Seite des Vaters rumlief, immer an der Hand des Vaters. Ich dachte: „Hat das mit den tradierten Vorstellungen zu tun, die das Kind daran hindert, sich den anderen Kindern anzuschließen?“ Dann bin ich hingegangen und habe mit dem Vater gesprochen. Anschließend habe ich dem Jungen gesagt: „Wenn du willst, spiel mit den anderen Kindern dort, da wird dir nichts passieren.“ Er hat mich mit einem Blick der Kälte, mit einem Blick des Todes angeschaut, der mich so sprachlos gemacht hat, bis der Vater mich aus dieser hilflosen Lage rausgeholt hat: „Lass den Jungen. Er ist nicht mehr gesund.“ Ich fragte ihn: „Wieso?“. Er antwortete: „Er hat seine Heimat verloren. Es sind schlimme Dinge passiert.“ Das war‘s, ich habe nicht mehr nachgefragt. Dann kam das Bild von Alan Kurdi an der türkischen Küste in die Presse. Das war der Punkt, wo ich dachte: „Ich muss was tun.“ Ich war wütend. Was konnte ich tun? Wenn du nichts hast, verweist es dich auf das, was übrig bleibt: die Sprache. Ich glaube, egal was man einem raubt, die Sprache ist immer da. Wenn sie da ist, habe ich mir gedacht, dann benutze ich sie. Dann habe ich diesen Roman geschrieben.
JS: Wieso lautet der Titel „Briefe aus Istanbul“? Es hätte auch eine andere Küstenstadt aus der Türkei sein können. Hat Istanbul hier eine Symbolkraft? Was symbolisiert hier Istanbul?
MB: Ich habe mich immer dagegen geweigert, dass ich irgendwann als ein Schriftsteller gelten werde, von dem man sagt: „Der baut die Brücken zwischen zwei Kulturen. Der erklärt uns, wie die Türken in Deutschland ticken.“ Das ist doch genau das, was von deutschschreibenden Schriftstellern mit türkischem Migrationshintergrund immer erwartet wird. Meiner Ansicht nach ist das eine Form von Ausgrenzung und Stigmatisierung. Warum soll ich nicht in einem Niveau wie Kafka schreiben können, der übrigens aus Tschechien kam, in deutsch schrieb und Themen behandelte, die nicht bloß migrantisch sind? Warum nicht schreiben können, wie ein Goethe oder Brecht? Das leuchtet mir bis heute nicht ein. Aber trotzdem ist da Istanbul. Darüber habe ich mich selbst gewundert. Istanbul ist meiner Ansicht nach die Mitte von zwei Regionen, die mit mir was zu tun haben, ohne dass ich beide gut genug kenne. Istanbul ist für die Berührung von beiden, dieses Symbol verkörpert der Bosporus. Es musste dort stattfinden. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Ein Schriftsteller weiß am Anfang nicht, was am Ende rauskommt. Das wissen Politiker, sollten es zumindest wissen, oder Philosophen wissen es gerne. Das Wagnis des literarischen Schreibens ist aber, dass du nicht weißt, wohin es geht. Als ich das Buch abgeschlossen habe, habe ich mich gefragt: „Warum jetzt Istanbul?“. Dann wurde mir klar, dass mir eigentlich meine soziale Biografie und meine Klasse die Aufgabe gibt, die Spuren zurückzuverfolgen, die mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Dann wurde mir erst klar, mag man es von mir erwarten oder nicht, ich habe die soziale, aber auch vorbiografische Pflicht zu erkunden, was die Türkei mit mir zu tun hat, was sie mir über mich verraten kann und was ich ihr über sie verraten kann. Das ist eine Aufgabenstellung, die mich seit diesem Buch verfolgt. Ich weiß nicht, wann sie endet. Mit „Briefe aus Istanbul“ hat sie begonnen.
JS: Ein zentraler Punkt in deinem Roman ist auch die „Schuldfrage“. Der Protagonist Ahmed stellt sich die Frage und diskutiert darüber mit anderen flüchtenden Menschen. Wer hat schlussendlich Schuld und welche Rolle spielen die Europäer?
MB: Wer Ursachen nicht kennt oder erkennen will, der sieht nur Schuldige oder Unschuldige. Insofern ist für mich die Frage der Schuld unerheblich. Inwiefern ich Europa oder Europäern eine Schuld vorwerfe, kann ich nicht sagen. Diese Fragestellung betrifft Ahmed, die Figur, die einem Europäer schreibt, ihm Briefe verschickt. Diese Frage betrifft die Leidenden. Ich war noch nie auf dem Mittelmeer auf einem überfüllten Schlauchboot und mit weinenden Kindern. Der Leser erfährt nicht, wie der Rechtsgelehrte in Paris auf die Briefe reagiert, wie er sie kommentiert und ob er sie beantwortet. Der Leser weiß nichts vom Empfänger. Warum? Weil es der Leser selbst sein könnte, an den geschrieben wird. Die Briefe möchten eine Erfahrung an den in Europa lebenden Menschen vorbringen, eine Erfahrung, die Europa geschichtlich sehr unbekannt ist. Es geht darum, sich selbst als den Anderen zu erfahren. Das ist eine Erfahrung, die zum Beispiel auch viele Türkeistämmige Menschen kennen. Das kenne ich auch von Menschen, die aus Afrika stammen, Freunde von mir. Das kenne ich von mir, obwohl ich hier aufgewachsen bin. Wir haben immer diesen Eindruck, aus der Sicht des Europäers ein Anderer zu sein. Wir sind Verdächtige. Warum kann nicht mal der Europäer ein Anderer, ein Fremder, ein Verdächtiger sein? Ich glaube, eine wichtige Frage der heutigen Zeit im 21.Jahrhunderts ist, ob in Europa lebende Menschen die Einsicht und Energie aufbringen können, zu verstehen, dass sie auch für andere Kulturen und für andere Völker Fremde sind. Den Bürgerlichen traue ich da nicht viel zu. Wir sehen ja, was sie bisher angerichtet haben und für Demokratie verkaufen. Die Frage geht eher an die Betrogenen und Geschlagenen, an uns. Ob wir die Fähigkeit erlernen können, davon wird viel abhängen. Das ist eine Frage, die das Buch verfolgt. Diese Frage wird Literatur nicht beantworten, aber die Frage kann sie stellen. Vielleicht sogar besser als die Politik.
JS: Du hast in „Junge Welt“ einen Artikel mit dem Namen „Konfrontative Literatur“ veröffentlicht. Was ist „konfrontative Literatur“ und welches Verhältnis hat es zu deinem Roman? Wie würdest du es in diesem Kontext einordnen?
MB: Das Essay ist eine Art Selbstbefragung, insofern dass man sich als Literaturmacher hinsetzt und die Frage stellt: „Was tue ich hier eigentlich und warum mache ich es?“ Ich glaube, dass Literatur diese Frage viel zu lange unter den Teppich gekehrt hat. Denn sie berührt die eigene Legitimität, die eigene Existenzberechtigung. In dem Essay ziehe ich Bilanz und formuliere einen Vorschlag. Literatur war geschichtlich immer dann fruchtbar, wenn sie mit dem realen Leben realer Menschen zu tun hatte. Also lasst unseren Blick auf dieses Leben richten. Es geht darum zu zeigen: „Es hängt von euch ab, ob es so bleibt, wie es ist.“ Das verstehe ich unter das Konfrontative. Konfrontation bedeutet ja nichts anderes als das Gegenüberstellen von zwei Positionen, zwei Meinungen, zwei Standpunkten, die sich nicht vertragen. Es gibt immer mindestens zwei Wege. Wenn ich in einer so widersprüchlichen Gesellschaft lebe wie der heutigen, vielleicht gab es noch nie eine widerspruchsvollere, dann habe ich mit dem Begriff der konfrontativen Literatur im Grunde genommen nur das am Wegrand aufgehoben, an dem jeder vorbeigeht. Das Konfrontative an „Briefe aus Istanbul“ ist der Moment, dass einer einem anderen Briefe schickt, von dem der Andere erst einmal lernen muss, dass er nur zuhört, weil er viel zu oft und viel zu lang gesprochen hat.
JS: Nächstes Jahr sind es 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei. Es gibt viele Dinge hinsichtlich der Geschichte der Arbeitermigration, die nicht ausreichend diskutiert bzw. beleuchtet wurden, obwohl es fast 60 Jahre sind. Hast du diesbezüglich Pläne für nächstes Jahr?
MB: Konkrete Veranstaltungsprojekte kommen und gehen, die klopfen an oder klopfen nicht an. Das überlasse ich denen, die es können. Ich schreibe gerade an einem Roman über meinen Onkel. Er hat in Deutschland von 1983 bis 1991 gelebt und dann wurde er abgeschoben. Inzwischen ist er gestorben, zu früh. Magenkrebs. In dem Buch thematisiere ich den Versuch, ob es möglich ist, an einem Ort anzukommen, auf den man nie vorbereitet war. Vielleicht wird das mein Beitrag. Das Buch steht sozusagen unter dem geringfügig abgewandelten Zitat eines für mich sehr wichtigen Denkers und Machers: „Rebellieren wir gegen die Herrschaft der falschen Gedanken“.
Das Interview führte Zeki Çapçı



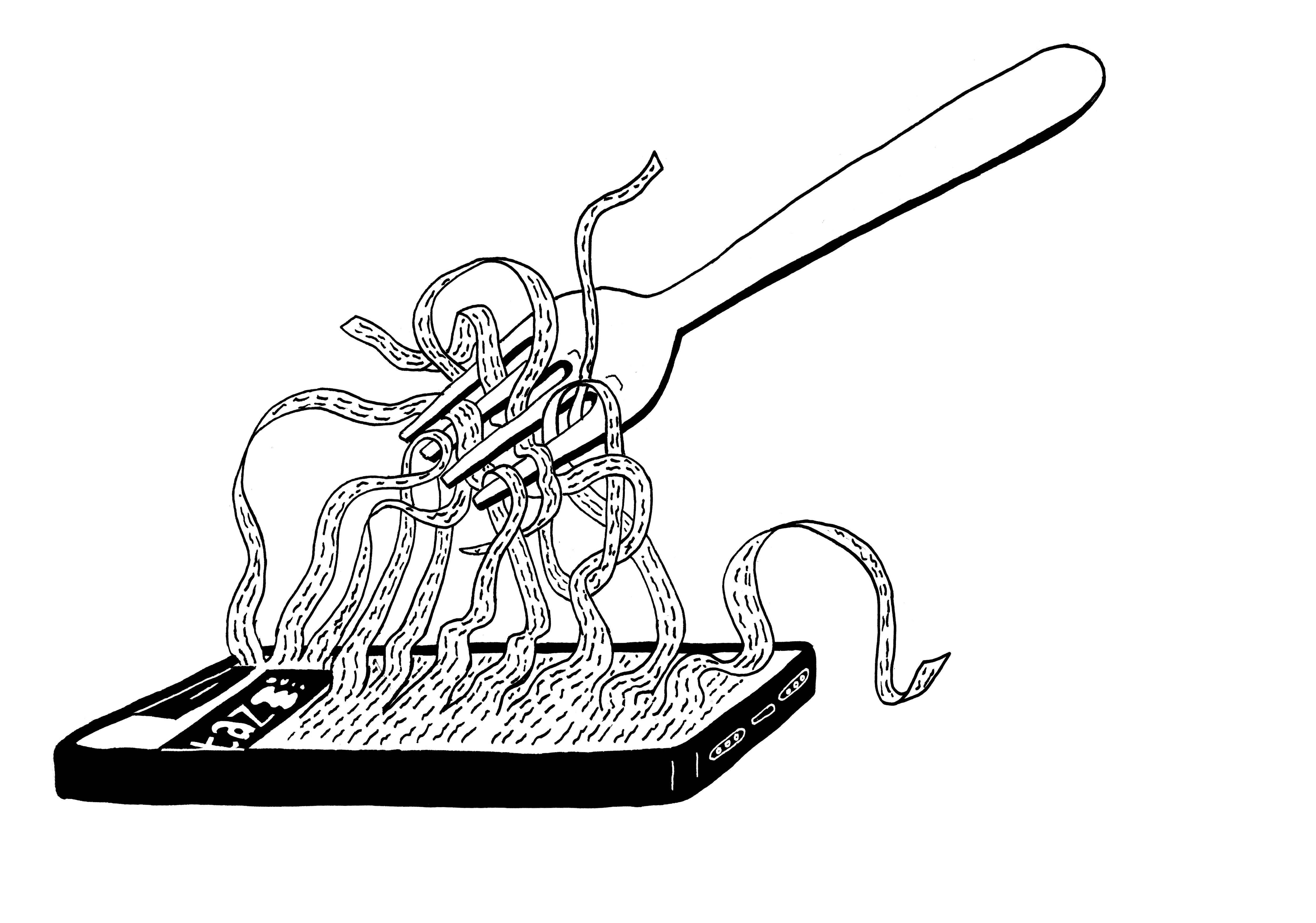
[…] Source link […]